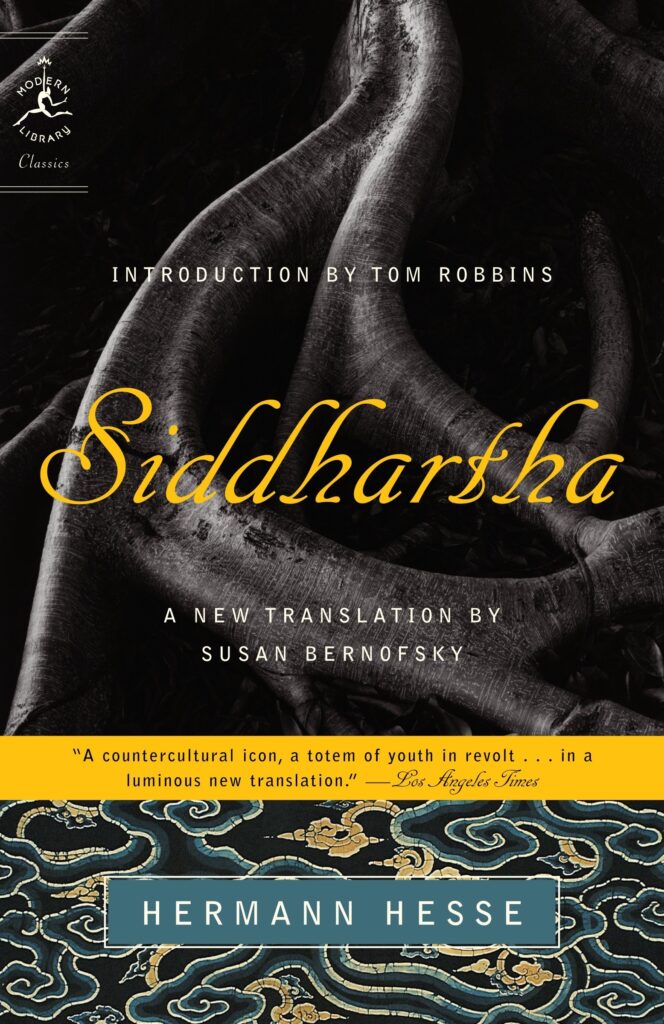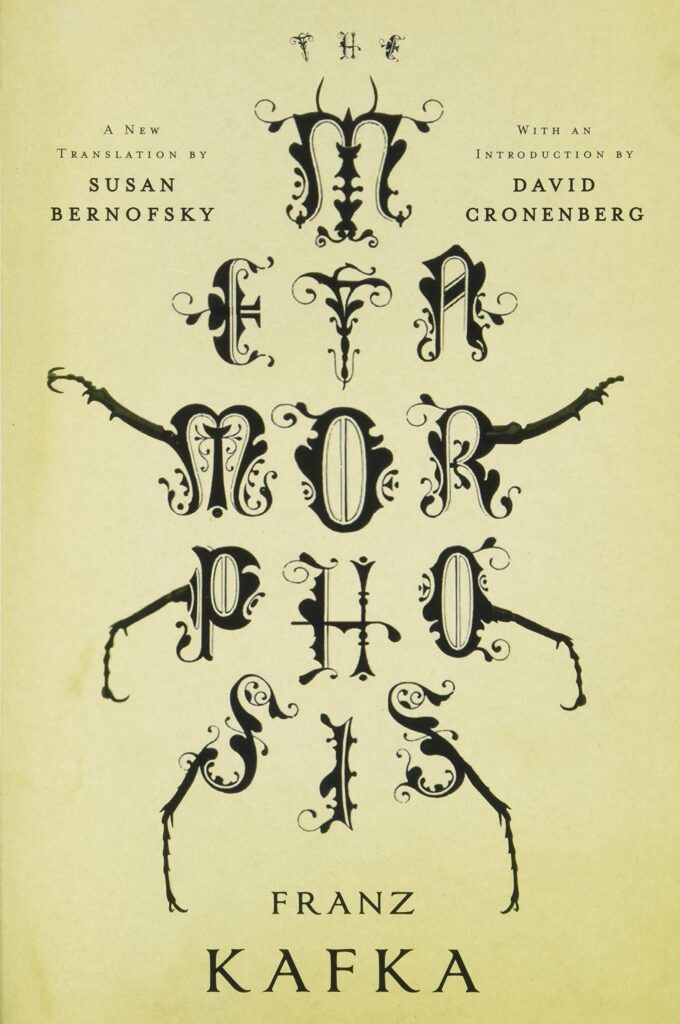Translation as Storytelling – Wie man beim Übersetzen eine Geschichte erzählt
Susan Bernofsky nimmt ihre Neuübersetzung von Thomas Manns Klassiker „Der Zauberberg“ zum Anlass, um darüber nachzudenken, wie die Geschichten, die Übersetzer∙innen über ein Werk erzählen wollen, den Blick für die eigene übersetzerische Arbeit schärfen können. Sie liest das monumentale Werk Manns als „Schweizer Märchen made in Germany“.
Ich denke gerade viel über die Geschichten nach, die ich beim Übersetzen erzähle, weil ich mich im Frühstadium einer umfangreichen Neuübersetzung befinde: Thomas Manns 1924 erstmals erschienenes Monumentalwerk Der Zauberberg. Es gibt zwei veröffentlichte Übersetzungen des Romans, die beide auf ihre Weise bewundernswert sind. Helen Lowe-Porter konnte Fragen mit dem Autor klären, und ihre Version aus dem Jahr 1927 trug zu Thomas Manns Weltruhm bei. (Sie diente vor einigen Jahren als Inspiration für Kate Briggs’ Buch über das Übersetzen, This Little Art [01]Briggs, Kate: This Little Art. London: Fitzcarraldo Editions 2017. .) 1995 veröffentlichte John E. Woods eine fantastische Neuübersetzung, die vor allem für das Einfangen von Manns Ironie und Humor gefeiert wurde. Der Roman ‚braucht’ also keine Neuübersetzung – die wäre nur nötig gewesen, wenn er vorher schlecht übersetzt worden wäre.
Als der Verlag W.W. Norton mit dem Wunsch nach einem neuen Zauberberg an mich herantrat, war mein erster Gedanke daher: Habe ich persönlich etwas über den Roman zu erzählen, was noch nicht ‚herausübersetzt’ wurde? Diese Herangehensweise habe ich bei meinen früheren Neuübersetzungen kanonischer Werke entwickelt (Hermann Hesses Siddhartha und Franz Kafkas Die Verwandlung).
Im Fall von Hesses Siddhartha – einer Erzählung, in der sich ein junger Mensch auf eine jahrelange Suche nach dem richtigen Leben begibt – drehte sich meine Geschichte um den Zusammenhang zwischen der vom Protagonisten angestrebten Erlösung und der lyrischen Prosa, die seine Suche beschreibt. Der begnadete Stilist Hesse schrieb eine Prosa, deren Sätze eine fast schon aggressive Melodik auszeichnet: assonanzenreich und von manchmal geradezu süßlicher Üppigkeit. Bei Siddhartha hatte ich den Eindruck, die harmonische Ausgewogenheit seiner Sätze diente Hesse als Gegenstück zur Weltsicht seines Romans – ein ergreifendes Projekt, wenn man bedenkt, dass er den Roman unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs begann. Die noch nie dagewesene Gewalt dieses Krieges, in dem mit Giftgas, Bombern und Panzern erstmals das Waffenarsenal des 20. Jahrhunderts eingesetzt wurde, tötete Millionen von Soldaten und hinterließ bei unzähligen Überlebenden körperliche Verstümmelungen und/oder psychische Narben. 1915 wurde der Ausdruck „shellshock“ geprägt (früher als „Kriegszittern“, heute meist als „Kriegsneurose“ übersetzt), um die Erfahrungen vieler Kriegsteilnehmer auf den Begriff zu bringen.
Als Europa noch unter den Verheerungen des Krieges – und der anschließenden Grippepandemie – litt, bot Hesse seinem jungen Helden die Möglichkeit zu einer radikalen Selbstentfaltung anstelle von Verwundung und Tod und schenkte ihm alle Zeit der Welt, um seine wahre Bestimmung zu finden. Die Prosa des Romans – melodisch fließende und im Einklang schwingende Sätze, die harmonische Ausgeglichenheit und gemessene Würde ausstrahlen – steht für ein Nirwana, eine Welt im Gleichgewicht.
Bei Kafkas Verwandlung hatte ich eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Für mich ist Gregor Samsa eine hysterische Zimperliese. Die Erzählung ist eine – zugegebenermaßen pechschwarze – Komödie, und Gregor ist immer der Angeschmierte. Kafkas Humor ist von trockener Situationskomik, die im Auseinanderklaffen von Gregors fieberhaften Anpassungsversuchen und seiner grotesken Körperform wurzelt. Dieser Angestellte par excellence ist so entsetzt darüber, dass er zu spät zur Arbeit kommen könnte, dass er das weit größere Problem seines monströs veränderten Körpers ausblendet; diese Charakterisierung veräppelt jede Vorstellung von Dienstfertigkeit. Seine Blamage wird noch komischer (aber auch trauriger), weil wir erkennen, dass er durch seine fanatische und bis zur Absurdität getriebene Beflissenheit sein Unheil auf spirituelle Weise selbst auf sich herabbeschworen hat. Dieses Melodram wollte ich in der ganzen Übersetzung so klar und deutlich wie nur möglich herausarbeiten.
Jetzt aber zum Zauberberg, diesem wahren Monolithen in der deutschen Literatur. Ich werde noch einige Zeit brauchen, um mich endgültig festzulegen, welche Geschichten ich in meiner Übersetzung erzählen möchte, und diese Geschichten können sich im Lauf der Arbeit an den tausend Seiten verändern. Eine erste Überlegung: Das Buch kommt mir wie ein überdimensioniertes Märchen vor, worauf mich eine Bemerkung im „Vorsatz“ des Romans gebracht hat: „Zudem könnte es sein, daß die unsrige [Geschichte] mit dem Märchen auch sonst, ihrer inneren Natur nach, das eine und andre zu schaffen hat.“ [02]Thomas Mann: Der Zauberberg. In: Große kommentierte Frankfurter Ausgabe, Bd. 5.1, hg. v. Michael Neumann. Frankfurt/Main: S. Fischer 2002, S. 10. Schon am Anfang des Buchs gibt es mehrere Stellen, an denen meine Übersetzung diese Lesart spiegelt.
Das Wort „einfach“ taucht sowohl im ersten Satz des „Vorsatzes“ als auch in der ersten Zeile des ersten Kapitels auf. In beiden Fällen erscheint es als Teil der Wendung „ein einfacher junger Mensch“. In der Rohübersetzung schrieb ich „simple young person“ und machte mich dann auf die Suche nach einem besseren Wort für das „simple“, denn der Protagonist von Thomas Manns Epochenroman ist schließlich kein „simpleton“, kein ‚Einfaltspinsel’. Ich hakte eine ganze Reihe möglicher Synonyme ab („regular“, „ordinary“ usw.) – mein Partner schlug als Ausdruck des 21. Jahrhunderts sogar „basic“ vor – und entschied mich schließlich für „unremarkable“ (‚unauffällig, unscheinbar’), ein ansprechendes Wort, das zur Ironie passt, mit der Thomas Mann dem/der Leser∙in über den Kopf der Romanfigur hinweg zuzwinkert.
Ist der Zauberberg nicht die Geschichte eines vertrauensseligen jungen Menschen?
Aber in welcher Art und Weise ist der junge Hans Castorp eigentlich „unremarkable“? Als erstes erfahren wir über ihn, dass er reich ist oder zumindest Umgang mit wohlhabenden Menschen pflegt: Er trägt eine auffällige „krokodilslederne Handtasche“, die ihm ein Konsul mit einem schick klingenden Namen geschenkt hat, der zugleich sein Onkel und sein Pflegevater ist. Schon seine Familiengeschichte ist offenbar alles andere als einfach. Natürlich kann das Wort ironisch gemeint sein. Ich zog Wörterbücher der Zeit heran, um mich schlau zu machen, wie „einfach“ und „simple“ im frühen 20. Jahrhundert verwendet wurden, und siehe da: Beide Ausdrücke hatten oft (= erster Unterpunkt in den jeweiligen Wörterbuchdefinitionen) die Bedeutung „arglos“ oder „ungekünstelt“. Und das hat Hand und Fuß. Ist der Zauberberg nicht die Geschichte eines vertrauensseligen jungen Menschen, der in einen Zug steigt, um „auf Besuch für drei Wochen“ zu fahren, und dem dieser Besuch auf unerwartete Weise über den Kopf wächst? Meiner Meinung nach erzählt Mann genau diese Geschichte. Vielleicht muss „einfach“ also doch ganz wörtlich mit „simple“ übersetzt werden. Fangen nicht viele Märchen damit an, dass sich „ein einfacher junger Mensch“ auf Reisen begibt? Und wenn auch die untergeordnete Bedeutung „nicht sehr klug“ mitklingt, ist das angesichts der leicht amüsierten und abgeklärten Erzählstimme vielleicht gar nicht so unangebracht.
Als ich weiter darüber nachdachte, musste ich an Emily Wilsons brillante Analyse des Anfangs von Homers Odyssee denken, in der sie Odysseus als „a complicated man“ beschreibt: Etymologisch geht der englische Begriff (ebenso wie das deutsche „kompliziert“) auf das lateinische „plicare“ (‚falten, wickeln’) zurück. Odysseus ist sowohl vielschichtig (wie ein zusammengefaltetes Tuch) als auch hierhin und dorthin gereist (seine Vergangenheit kennt viele Wendungen). Er ist ein Mann „mit Falten“, das com und pli von „complicated“. Und wie sich zeigte, geht auch das ple in „simple“ auf „plicare“ zurück (sim ist von indogermanisch sem, „eins“ abgeleitet). Simpel ist, was nur eine Wendung oder Falte hat. Damit ist es gar kein so schlechtes metaphorisches Äquivalent für das deutsche „einfach“, das auf „ein Fach“ zurückgeht – und „Fach“ hatte im Mittelhochdeutschen auch die Nebenbedeutung „Falte“.

Allerleirauh
Im Fortgang der Übersetzung finde ich immer mehr Passagen, die die Bedeutung des Märchenhaften für Manns Roman bestätigen. Das Haus, in dem Hans Castorp einen Gutteil seiner frühen Kindheit verlebt, wird beispielsweise als „in einer trüben Wetterfarbe gestrichen“ beschrieben. In einem frühen Entwurf meiner Übersetzung stand noch „painted a glaucous hue“ (‚in graublauem Farbton gestrichen’), denn das von Mann beschriebene Hamburger Wetter ist oft düster und grau. Dann dachte ich aber weiter über das Wort „Wetterfarbe“ nach – ein wahrlich seltsames Wort, das ich in deutschen Wörterbüchern selbst aus dem 19. Jahrhundert nirgends finden konnte. Schließlich fand ich es aber doch: in einer anonymen deutschen Übersetzung von Charles Perraults Märchen „Peau d’Âne“ (‚Eselsfell’) aus dem 19. Jahrhundert. [03]Anon.: Echte und wahrhafte Feen-Mährchen. 2. Aufl. Bd. 1. Stuttgart: Franz Heinrich Köhler 1839, S. 100-116, hier S. 104. Die Brüder Grimm nahmen die Bearbeitung dieses Märchens unter dem inzwischen berühmt gewordenen Titel „Allerleihrauh“ in ihre Sammlung auf, das entscheidende Wort taucht in ihrer Version der Geschichte allerdings nicht auf. [04]Jacob Grimm, Wilhelm Grimm und Jack Zipes: „All Fur (Allerleirauh)“. In: The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm: The … Fußnote lesen In Perraults Märchen versucht eine von Inzest bedrohte junge Frau (ihr Vater will sie heiraten), sich zu retten, indem sie ihm Prüfungen auferlegt, und als erstes bittet sie ihn um ‚ein Kleid von Wetterfarbe’ („une robe de la couleur du temps“), die sich später als himmelblau herausstellt. [05]Charles Perrault: Peau d’Âne. In: Contes, hg. v. Marc Soriano. Paris: Flammarion 1989, S. 217-232, hier S. 221. Ich könnte mir denken, dass Mann dieses Märchen als Kind auf Deutsch gelesen hat (oder vorgelesen bekam), und dass die faszinierende Märchenfarbe ihm im Gedächtnis blieb. (Dass das französische Wort „temps“ sowohl ‚Zeit’ als auch ‚Wetter’ bezeichnet, verleiht Hans Castorps Geschichte, in der Zeit eine wichtige Rolle spielt, eine zusätzliche verborgene Ironie.) Erst einmal beschreibe ich das Haus in meiner Übersetzung als „somberly painted the color of the weather“ (‚in der düsteren Farbe des Wetters gestrichen’).
Eine andere Geschichte, die ich über Manns Roman erzählen möchte, hat mit dem Tourismus zu tun. Wir werden wiederholt daran erinnert, dass der Protagonist aus Hamburg kommt und die Schweizer Kulisse des Romans als exotisch erfährt. Beim ersten Anblick der Alpen gerät Castorp ins Schwärmen, und er findet es entzückend pittoresk, dass eine Bedienung in Davos nicht „Kellnerin“, sondern mit dem damals gängigen Schweizer Ausdruck „Saaltochter“ genannt wird. Durch meine jahrzehntelange Beschäftigung mit Robert Walser habe ich eine enge Beziehung zur Schweiz, die Landschaften des Romans sind mir sehr nah, und ich möchte sie so touristisch beschreiben, wie die Norddeutschen Hans Castorp und Mann sie damals wahrgenommen haben. So werden die meisten Orte und Regionen in diesem mehrsprachigen Umfeld – die Schweiz hat ja vier Amtssprachen – bei mir wahrscheinlich mit ihren deutschen Namen auftauchen (also eher „Graubünden“ als „Grisons“). Ein Nachschlagewerk, das ich dabei heranziehe, ist ein Baedeker der vorletzten Jahrhundertwende.
Dann ist es mir auch sehr wichtig, die kulturellen Artefakte des Romans in meiner Übersetzung detailgetreu wiederzugeben. Ironischerweise ist das dank dem Internet und den digitalen Freihandbibliotheken des 21. Jahrhunderts für mich leichter als für die beiden früheren Übersetzer∙innen des Romans. Lowe-Porter hatte Zugang zum Autor – wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Mann daran gelegen war, ihr alle Realien des Romans haarklein zu erklären –, und auch Woods’ Übersetzung entstand vor der Blütezeit des Internets. Der Zauberberg ist indes gespickt mit Dingen, die recherchiert werden müssen.
Hans Castorps Vetter – den er in Davos besucht – macht sich zum Beispiel über eine weltfremde Mitpatientin lustig, deren Ausdrucksweise von Malapropismen nur so wimmelt. Ein besonders auffälliger Schnitzer ist, dass sie aus einem „Stilett“ ein „Sterilett“ macht. Als Mann seinen Roman schrieb, war ein „Stilett“ nur ein ‚kleiner Dolch mit dreikantiger Klinge’, hatte noch nichts mit Stöckelschuhen zu tun und wäre der verspotteten Dame exotisch vorgekommen. Unseligerweise verwechselt sie den Begriff mit einem Wort, das damals nicht salonfähig war: Ein „Sterilett“ (vom französischen „stérilet“) war ein Vorläufer des Pessars, das Margaret Sanger 1921 in ihrer Broschüre „The Use of the Pessary“ propagierte. Es wäre naheliegend, auf denselben historischen Malapropismus („steriletto“) zurückzugreifen wie Lowe-Porter, aber ich möchte, dass auch eine heutige Leserschaft an dieser Stelle den wirklich oberpeinlichen Patzer mitbekommt. Woods übersetzt das Wort als „Stirletto“, erfasste also die falsche Aussprache, aber nicht die Unschicklichkeit. Vorläufig habe ich das „Stilett“ verworfen und experimentiere mit Spielarten von „switchblade“ (‚Springmesser’). Am besten gefällt mir bisher „snatchblade“ (etwa ‚Büchsenmesser’ [06]Anmerkung des Übersetzers der Übersetzerin: Die Bedeutung von Bernofskys neologistischem Portmanteauwort „snatchblade“ geht in Richtung von … Fußnote lesen), das den grausamen und schadenfrohen Humor der Männer einfängt, der für die Atmosphäre von Manns Roman meiner Meinung nach sehr wichtig ist.
Ein Schweizer Märchen, made in Germany.
Das wäre also eine erste Schilderung meiner Herangehensweise an dieses Schweizer Märchen, made in Germany. Meine Ideen zu dem Buch dürften sich beim Weiterarbeiten verändern und entwickeln; ich wollte mit dieser Momentaufnahme einer noch im Entstehen befindlichen Arbeit beispielhaft zeigen, wie man sich einem solchen Projekt nähern kann. Ein Nachdenken über die Geschichten, die wir über ein Werk erzählen wollen, kann den Blick für die anstehende Arbeit schärfen. Hoffentlich trägt es auch dazu bei, dass möglichst alles in meiner Übersetzung von Manns Roman mit dem richtigen Wort benannt wird.
Eine englische Kurzfassung dieses Essays erschien in frieze, Nr. 216, Jan./Febr. 2021, S. 76-81.
| ↑01 | Briggs, Kate: This Little Art. London: Fitzcarraldo Editions 2017. |
|---|---|
| ↑02 | Thomas Mann: Der Zauberberg. In: Große kommentierte Frankfurter Ausgabe, Bd. 5.1, hg. v. Michael Neumann. Frankfurt/Main: S. Fischer 2002, S. 10. |
| ↑03 | Anon.: Echte und wahrhafte Feen-Mährchen. 2. Aufl. Bd. 1. Stuttgart: Franz Heinrich Köhler 1839, S. 100-116, hier S. 104. |
| ↑04 | Jacob Grimm, Wilhelm Grimm und Jack Zipes: „All Fur (Allerleirauh)“. In: The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm: The Complete First Edition. Princeton: Princeton UP 2015, S. 216-220. |
| ↑05 | Charles Perrault: Peau d’Âne. In: Contes, hg. v. Marc Soriano. Paris: Flammarion 1989, S. 217-232, hier S. 221. |
| ↑06 | Anmerkung des Übersetzers der Übersetzerin: Die Bedeutung von Bernofskys neologistischem Portmanteauwort „snatchblade“ geht in Richtung von ‚Klappmesser’ oder ‚Schnappmesser’, „snatch“ bedeutet aber auch ‚schnell ergreifen’ und ist als Substantiv ein Slangausdruck für das weibliche Geschlechtsorgan. |