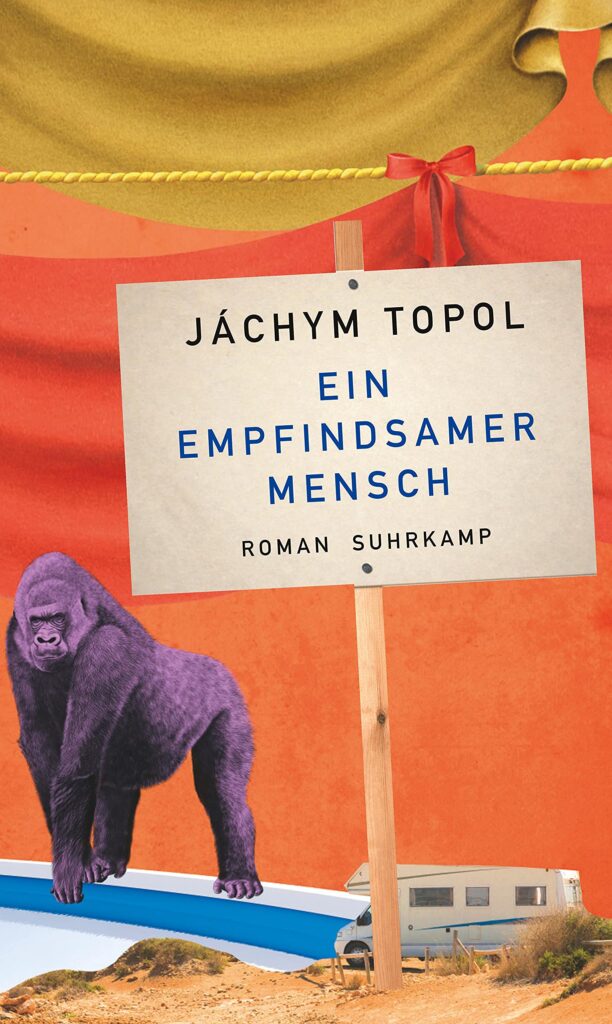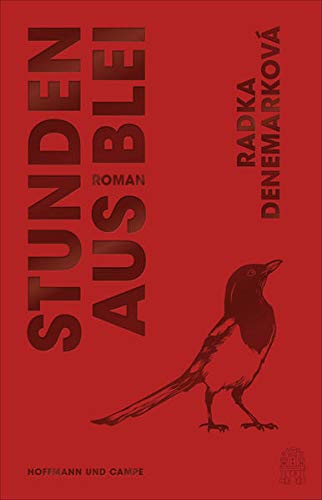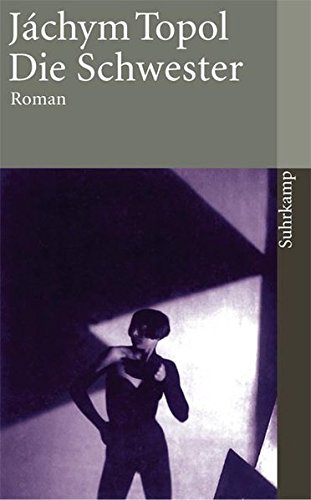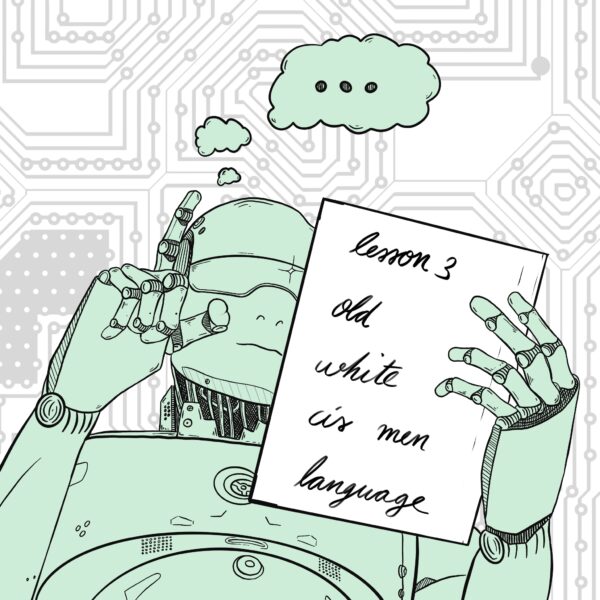Du sollst nicht begehren die Sprache deines Nächsten: Übersetzen in eine andere als die eigene Muttersprache
Wenn Autoren ihre Heimat verlassen und in einem fremden Land und einer fremden Sprache heimisch werden, wird dies oft als Bereicherung für die Literatur angesehen. Anders verhält es sich bei Übersetzern.
Verliere ich als Schreibende – durch Exil oder Umzug – mein Sprachmaterial, bleibe ich entweder für meine neue Heimat stumm oder schreibe in einer fremden Sprache weiter: so Vladimir Nabokov auf Englisch oder Libuše Moníková auf Deutsch. Für gewöhnlich wird dies als kreativer Akt und Bereicherung für die Literatur des Gastlandes gefeiert. Habe ich mir als Übersetzerin eine fremde Sprache zu eigen gemacht, wird es jedoch weniger als ein Akt der Kreativität, sondern eher als ein Tabubruch gesehen. Für mich, die ich seit über zwanzig Jahren hartnäckig gegen das Gebot der Muttersprachlichkeit verstoße, stellen sich gleich mehrere Fragen: Ist das mir immer wieder entgegengebrachte Kopfschütteln ein gesellschaftliches oder ein sprachliches Problem? Wie hält es das Deutsche mit dem Fremden? Lässt sich ein literarischer Text auch ohne perfekte Kenntnis der Zielsprache wirkungsäquivalent übersetzen? Oder hängt das oben erwähnte Unbehagen lediglich mit der gängigen Berufsauffassung zusammen: Als Übersetzerin habe ich dem Text zu dienen, also keine persönlichen Spuren zu hinterlassen?
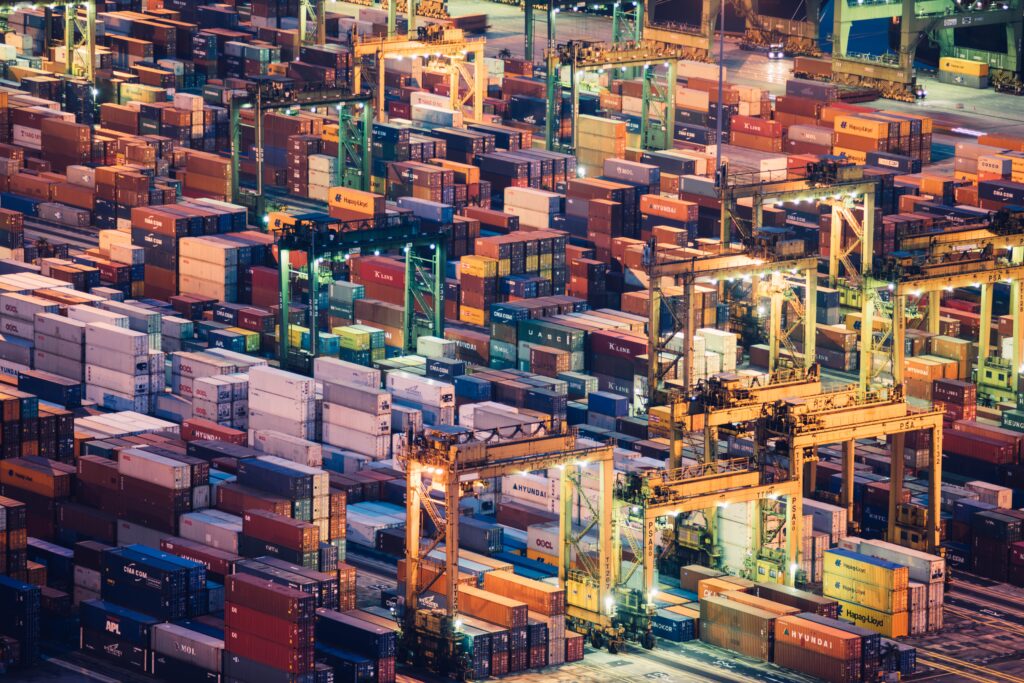
Was ist das Übersetzen überhaupt? Das tschechische Verb překládat heißt nicht nur übersetzen oder Ware bzw. Fracht umladen bzw. löschen, sondern neben bildlich umschreiben auch transponieren (ein Musikstück in eine andere Tonart versetzen). Das alles schwingt in der Tätigkeit mit. Ich lade die mir (an)vertraute Fracht um, gebe dem Inhalt eine neue, bildliche Form und transponiere ihn – samt mir selbst – in eine andere „Tonart“, ins Deutsche also. Der Rhythmus, die Segmentierung bleiben, aber die Stimme klingt entsprechend dem neuen, anderen Material etwas anders; genauso wie meine Stimme im Tschechischen höher, fragender klingt und im Deutschen tiefer, bestimmter.[01]Wie eine solche Überfahrt konkret aussieht, kann man im Log- und Tagebuch zu meiner Übersetzung von Radka Denemarkovás „Stunden aus … Fußnote lesen
Woher nehme ich denn die Legitimation, in eine andere als die eigene Muttersprache zu übersetzen? Einzig und allein aus der Begründung ICH WILL!
Was ist das Übersetzen also für mich? Eine Art dreifache Wahrnehmung: Die Augen lesen auf Tschechisch, das Gehirn analysiert die sprachlichen Phänomene in Bezug auf mögliche deutsche Äquivalenzen und das Ohr hört bereits einen deutschen Text (noch nicht ausgemalt, sprich ausformuliert) im Rhythmus des Originals. Die Niederschrift der ersten Fassung ist leicht: Wie beim Klavierspielen huschen die Finger über die Tastatur und bringen flugs einen tschechischen Text im deutschen Pelz hervor. In dieser Phase bin ich häufig so von dem tschechischen Duktus begeistert, dass ich mit Freude gegen die dem Deutschen immanente Denklogik und ihre Satzordnung verstoße; Worte, für die ich auf Anhieb keine Übersetzung weiß, werden umschrieben; und nicht nur bei idiomatischen Wendungen folge ich stur dem Original. Bringt so die erste Fassung viel Spaß, arten die nächsten Durchgänge in eine Plackerei aus: Mühsam pflüge ich die Sätze auf der Suche nach einer deutschen Satzperspektive um und versuche weiterhin, dem deutschen Text die Atmung des Originals beizubringen (je mündlicher der Ausgangstext, desto stärker versuche ich die Länge der deutschen Sätze der ihrer tschechischen Kameraden anzupassen), wälze Wörterbücher und forsche im Internet, und das so lange, bis ich eine Fassung habe, in der ich beim lauten Vorlesen nur noch die Stolperstellen wegschleifen muss. Dass das ganze Prozedere viel zu viele Runden beansprucht und wirtschaftlich einer Selbstausbeutung gleicht, das dürfte vielen Kolleg:innen vertraut sein: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Übersetzerbrot essen! Die brennende Hochstaplerangst aber, die mir ständig im Nacken hockt, die Angst, gleich hebt einer den Finger und sagt, was macht diese Frau hier, die Dahergelaufene, wer hat ihr erlaubt, in unserer Sprache herumzuwerkeln, raus mit ihr!, diese Angst ist mein Maluspunkt, der Zoll, den ich für meine Nichtmuttersprachlichkeit zu entrichten habe. Besonders wenn ich als Mentorin oder Werkstattleiterin zu Wort komme, aber auch im stillen Kämmerlein legt sie mich manchmal fast lahm: Woher nehme ich denn die Legitimation, in eine andere als die eigene Muttersprache zu übersetzen? Einzig und allein aus der Begründung ICH WILL! Denn gleichzeitig, und das immer mehr, ist das Übersetzen für mich ein Akt der Selbstermächtigung und des Willens, endlich in diesem Land anzukommen (Einbürgerung bringt diesbezüglich wenig). Ich male meine Konturen mit neuer Farbe aus, schlage eine Brücke zwischen dem alten und dem neuen Ich, ignoriere das leierkastenmäßige Geht nicht. Da hättest du als Kind hierherkommen müssen! und werde (endlich) subversiv: Geht nicht? Euer Ernst? Dann wollen wir doch mal schauen!
1983, als ich als Zwanzigjährige nach der Flucht aus der Tschechoslowakei in Deutschland politisches Asyl beantragte, war mein Sprachfenster schon zu. Obwohl ich Deutsch seit der dritten Grundschulklasse gelernt und sogar in Prag an der Karlsuniversität zwei Semester lang das Fach Übersetzen/Dolmetschen Deutsch und Englisch studiert hatte, konnte ich damals besser lesen als verstehen. Auch heute tue ich mich mit deutschen Dialekten schwer und vor einer Geräuschkulisse – Radio, Bahnhofsansagen, Buchmessenrauschen – einer Unterhaltung zu folgen, kostet mich im Deutschen erheblich mehr Konzentration und Stirnrunzeln als im Tschechischen. Zählen tue ich bis heute nur in meiner Muttersprache und meine Telefon- und Kontonummer kann ich nur auf Tschechisch aufsagen. Obwohl ich seit Langem auf Deutsch denke, ist Deutsch für mich immer noch eine Fremdsprache. Das richtige Wort, den richtigen Ausdruck zu finden ist keine Frage der Intuition, sondern die des Speichersystems. Häufig erfolgt die Suche fast automatisch, gerate ich aber unter Stress oder bin ich müde, taucht mein Akzent wieder auf, die Sprache fühlt sich fremd an auf der Zunge und die Worte spielen Verstecken mit mir, ich sehe nur ihre Umrisse, nicht den Wortlaut – und verdrehe dann die Buchstaben oder die Teile der Komposita. Obwohl ich über die deutsche Grammatik mehr weiß als ein durchschnittsdeutscher Uni-Absolvent, verwechsele ich bis heute manchmal auf mit an und hin mit her oder verstoße gegen die deutsche Zeitenfolge (das tschechische Tempussystem kennt kein Perfekt und schon überhaupt kein Plusquamperfekt). Auch die Entscheidung zwischen bestimmtem oder unbestimmtem Artikel treffe ich nicht automatisch, sondern rufe sie ab – denn Artikel gibt es in dieser Form im Tschechischen nicht. Auftrumpfen kann ich aber mit der Lexik, sie ist mein Ausgleich für all die grammatikalischen Zipperleins einer Nichtmuttersprachlerin. Da ich mein Deutsch und seine Prosodie vorwiegend aus dem Alltag beziehe, bin ich mit der Übertragung von zeitgenössischer, mündlicher Prosa am glücklichsten. Ältere Texte würden mir mehr Respekt einflößen.
Meine ersten Übersetzungen ins Deutsche waren eher sehr anspruchsvolle Deutschkurse als Tandem-Übersetzungen: Zusammen mit Studienfreundinnen übersetzte ich schon Anfang der 90er Jahre Tereza Boučková (mit Kathrin Liedtke) und Lyrik von Jáchym Topol (mit Anja Tippner), vor allem aber seine Prosa (mit Beate Smandek). Die Rollenbeschreibung war klar: Ich das wandelnde Lexikon, sie die Sprachkünstlerinnen, zu denen ich hochachtungsvoll aufblickte. Moi universitety, um es mit Maxim Gorki zu sagen. Irgendwann mal wollte ich aber „allein spielen“ und musste Schritt für Schritt neu anfangen, von Viewegh über Rudiš und Denemarková zu Topol zurück.
Was heißt das Übersetzen nun wirklich für mich? Horchen, horten, mopsen, klauen.
Was heißt das Übersetzen nun wirklich für mich? Horchen, horten, mopsen, klauen. Ich wildere in Wörterbüchern (Grimm! Goethe! Küpper!), im Internet und in Büchern, sei es in den original auf Deutsch geschriebenen oder den übersetzten – obwohl letztere fast ergiebiger sind: ein Hoch auf die Kolleg:innen! – ich belausche Gespräche am Nachbartisch, halte in der U-Bahn die Ohren steif, weder Freund noch Feind sind vor mir gefeit. Sehe ich irgendwo ein knackiges Wort oder eine hübsche Redewendung herumflattern, greife ich danach; wie ein Schmetterlingsjäger nie das Haus ohne sein Netz verlässt, steckt immer ein Heftchen in meiner Tasche. Dem tschechisch-deutschen Lexikon von Hugo Siebenschein vertraue ich wenig, sein Wortschatz ist entweder veraltet oder immer noch sozialistisch angehaucht, es weist mir im Notfall lediglich die Richtung, dann sind DUDEN, DWDS, das Internet und meine Sammlungen dran. Bei der Textarbeit lege ich meine Fundstücke wie Fotonegative aufeinander, schiebe sie hin und her, halte sie gegen das Licht, schaue, ob sie die Lücke füllen, und wenn nicht, warte ich mit neuen Synonymen auf, bis ich meine, das Wort gefunden zu haben, das zu dem von mir übersetzten Text passt. Es sollte nicht nur inhaltlich übereinstimmen, sondern sich auch längenmäßig gut in den Satz einfügen: Die Phrasierung, die das Original mitbringt, ist mir wichtig. Auch wenn ich die im Tschechischen sehr beliebte Konjunktion und immer wieder durch ein Komma ersetzen muss, versuche ich dem Satzgefüge trotzdem einen ähnlichen Atemrhythmus beizubringen.
Wie es sich anfühlt, in eine andere Sprache als die Muttersprache zu übersetzen? Im Ausgangstext wie im warmen Fruchtwasser planschen. Ein perfektes, intuitives Verständnis für alle Sprachnuancen haben. Ist der Text gut geschrieben, weiß ich auf Anhieb, was ihn innerlich zusammenhält, und habe gleich eine Vorstellung, wie er auf Deutsch klingen könnte (dies herzustellen, steht auf einem anderen Blatt). Ist er schlecht geschrieben, stellt sich mein „deutsches“ Ohr taub; dann wird die Sache heikel. – Wie stark mich meine Muttersprache trägt, habe ich erst neulich bei einer Übersetzung aus dem Slowakischen verstanden, das dem Tschechischen so nahe steht wie keine andere Sprache sonst: Das intuitive Verständnis war weg, ich tappte im Dunkeln, konnte Ironie nicht von Meckern unterscheiden und Abweichungen in der Satzmelodie musste ich bei der Autorin erfragen. – Je leichter es mir fällt, das Original zu verstehen, umso dornenreicher und kräftezehrender ist der Weg ins Deutsche. Spätestens ab dem dritten Durchgang beneide ich meine muttersprachlichen Kolleg:innen um ihr Fruchtwasserbad und fluche wie ein Spatz, welcher Teufel mich bloß geritten hat, ins Deutsche zu übersetzen. Das darf man jedoch nicht ernst nehmen: Allen Flüchen und jedem Gejammer zum Trotz bin ich eine Wiederholungstäterin und mache stur weiter. Wie gut sich aber mit meinen Übersetzungen arbeiten lässt, wie viel Mehrarbeit das Lektorat leisten muss, wie der Text klingen würde, wenn er von jemand anders in seine deutsche Muttersprache übersetzt worden wäre – diese Frage müssten andere beantworten.
Ich merke nur, dass sich allmählich etwas verschiebt. Hatte ich anfangs Angst, Fehler zu machen, mich mit fremdem Akzent als Ausländerin zu outen, bin ich heute immer mehr bereit, mich zu meiner Herkunft zu bekennen und finde sie gleichzeitig immer weniger wichtig. Wir alle kommen doch von irgendwoher, also was soll das. Aber es reizt mich zunehmend, nicht mehr nur tschechische Literatur zu vermitteln, sondern selbst einen Abdruck zu hinterlassen: ein tschechisches Wasserzeichen, einen Gruß an die alte Heimat, ein Geschenk an die deutschen Leser. Bei Jáchym Topols Ein empfindsamer Mensch [02]Jáchym Topol, Ein empfindsamer Mensch, Suhrkamp 2019., der aus allen Sprachschichten des Tschechischen schöpft, machte es mir Spaß, auch das österreichische Deutsch zu bemühen (mit dem das Tschechische seit den gemeinsamen K&K-Tagen viele Berührungspunkte hat): ein Feschak (fešák) in Shorts; bräunliche Fatschen (fáče) um den Kopf. Dieser Vorgang (Entlehnung von österreichischer oder bayerischer Lexik) ist in dem häufig aufs Glätten bedachten deutschen Lektorat fast ähnlich tabuisiert wie das Übersetzen in die Nichtmuttersprache. Warum eigentlich? Wie wichtig für die heutige Sprachwahrnehmung ist ein solcher durch die Elbe markierter Sprach-Äquator überhaupt? (Denn auch umgekehrt ist es ein enormer Verhandlungsakt, will ich einem österreichischen Verlag ein paar norddeutsche Ausdrücke wie zum Beispiel plietsch oder Feudel unterjubeln). Bei meiner letzten Übersetzung (Radka Denemarkovás Stunden aus Blei[03]Radka Denemarková, Stunden aus Blei, Hoffmann und Campe Verlag 2022.) ertappte ich mich dabei, dass ich an manchen Stellen bewusst tschechische Redewendungen ins Deutsche transportierte: Wenn das Bild stimmt und das Deutsche über kein passendes Äquivalent verfügt, übersetze ich, was im Original steht. So gebe ich indirekt dem Deutschen zurück, was meine Landsleute ihm vor zweihundert Jahren entwendeten: den tschechischen Humus. Damals, unter den Habsburgern, war Deutsch die Landessprache und Tschechisch wurde nur vom niederen Volk gesprochen, den Kutschern und Dienstmädchen. Die ersten tschechischen Schriftsteller wie Karel Hynek Mácha (1810 – 1836) oder Božena Němcová (1820 – 1862) wuchsen deutschsprachig auf und brachten sich das Tschechische selbst bei, indem sie dem Volk aufs Maul schauten. In Form von Verballhornungen hält sich das Deutsche bis heute in der tschechischen Umgangssprache (verkcajk, mašinfíra, ksicht); je mehr davon, desto urtümlicher, volksnaher will sich der Sprecher geben.
So schreibe ich die gemeinsame deutsch-tschechische Literatur fort. War das Übersetzen anfangs eine Auseinandersetzung mit dem Exil (Die Schwester von Jáchym Topol[04]Jáchym Topol, Die Schwester, übersetzt gemeinsam mit Beate Smandek, Volk & Welt 1998 . war wie nach Hause kommen, alles so vertraut: die Sprache, die Realien!) und ein Wunsch, meinem Gastland mein Herkunftsland näher zu bringen, ist es inzwischen ein bewusster Beitrag zu einer sprachlich-gesellschaftlichen Polyphonie geworden.
| ↑01 | Wie eine solche Überfahrt konkret aussieht, kann man im Log- und Tagebuch zu meiner Übersetzung von Radka Denemarkovás „Stunden aus Blei“ nachlesen, erschienen bei TOLEDO. |
|---|---|
| ↑02 | Jáchym Topol, Ein empfindsamer Mensch, Suhrkamp 2019. |
| ↑03 | Radka Denemarková, Stunden aus Blei, Hoffmann und Campe Verlag 2022. |
| ↑04 | Jáchym Topol, Die Schwester, übersetzt gemeinsam mit Beate Smandek, Volk & Welt 1998 . |