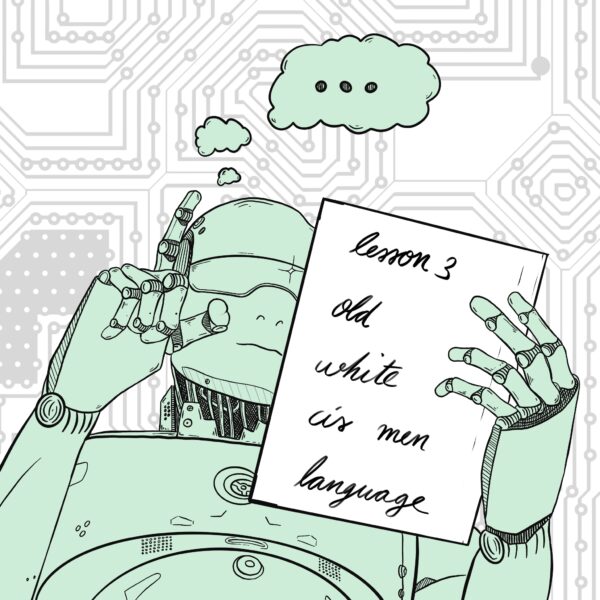Fasern und Fransen: Das Text-Gewebe vom Stoff zur Zelle.
Susanne Lange nähert sich der Beschaffenheit des Übersetzungstextes anhand diverser Vorstellungen von Gewebe.
Von jeher wurde gern das Schneiderhandwerk herangezogen, um sich den Begriff des Übersetzens zu „übersetzen“ oder anzumessen. Im 17. Jahrhundert dachte man, das fremde Original müsse in heimischer Tracht erscheinen, einerlei, wie sehr es dabei zurechtgestutzt würde, damit es in den neuen Rock passe. Munter fügte man noch allerlei Borten und Paspeln hinzu. Die Vorstellung eines Inhalts, der beim Übersetzen einen neuen Mantel übergeworfen bekommt, hat sich mit der Entwicklung der Sprachphilosophie grundlegend geändert, die das Mitgeteilte in unauflöslicher Verbindung mit seiner Form sieht. Demnach trägt der zu übersetzende Text kein fremdes Sprachkleid mehr, sondern wird selbst zum „Gewebe,“ wie auch der lateinische Begriff „textum“ ein Gewebe, ein Stoffgeflecht und im übertragenen Sinn ein stilistisches Geflecht aus Redeelementen meint. Das im Text Mitgeteilte wird also selbst zum Stoff, zum Gewebe, das es in der Übersetzung nicht zurechtzuschneidern, sondern von Grund auf neu zu weben gilt.
Ein Gewebe mag simpel betrachtet eine Verbindung sich kreuzender Fäden sein, diente aber schon früh und nicht nur im Lateinischen für metaphorische Verknüpfungen. Eine dieser Metaphern hat etwa Jorge Luis Borges in seinem Gedicht „Fragmento“ aus dem Altnordischen entliehen, nach dem die Schlacht ein „Gewebe von Männern“ ist. Dass ein Gewebe trotz des regelmäßigen Herstellungsprinzips kein Bild für klare Transparenz bietet, zeigt auch sein metaphorischer Gebrauch in Wörtern wie „Lügengewebe.“ Ebenso ist das „Weben“ eine Tätigkeit, die mystischen Kräften der Natur zugeschrieben wird. Goethes Erdgeist zu Beginn des „Faust“ webt beherzt am „sausenden Webstuhl der Zeit.“ Dem Ergebnis des Webens haftet jedoch auch etwas Fragiles, Zartes an. So kennt das Grimmsche Wörterbuch noch den Begriff „Wortgewebe“ und schreibt in der Erklärung dazu: „doch bleibt in wortgewebe das bildhafte, besonders im sinne des feinen, zierlichen, verletzlichen noch fühlbar.“[01]https://www.dwds.de/wb/dwb/wortgewebe Wir haben es also mit einem Gebilde zu tun, das höchstes Fingerspitzengefühl voraussetzt.
Doch bleiben wir beim Stofflichen. Die Verflechtung von Längs- und Querfäden, Kette und Schuss, kann die raffiniertesten Farb- und Lochmuster bilden, in der Breite variieren und in der Textur. Gerade die Struktur, die Textur dieses „textum,“ interessiert uns im Hinblick auf die Übersetzung. Ein Nachweben mit den Fäden einer anderen Sprache sollte natürlich das Gewebemuster, aber vor allem auch dessen Textur nachschaffen, d. h. die Unebenheiten, die haptischen Unregelmäßigkeiten – die sich im Übrigen, wie bei Textilien, nur bei handgeknüpften Übersetzungen erzeugen lassen, nicht bei maschinellen –, die losen Fransen an den Texträndern. Zum Thema „Franse“ schreibt Walter Benjamin 1934 in seinen „Protokollen zu Drogenversuchen:“ „Die Fransen sind wichtig. An den Fransen erkennt man das Gewebe. Wollquatsch.“[02]Walter Benjamin: „Gesammelte Schriften. VI,“ hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M. 1985, S. 614, siehe auch: … Fußnote lesen Es gilt also, sozusagen vom Textrand her zu übersetzen, um ein Gefühl für diese Fransen zu bekommen, die das Gewebe ausmachen, also auch den Gesetzmäßigkeiten eines „Wortquatschs“ zu folgen. Gerade was der klaren Struktur gekreuzter Sprachfäden entkommt, bildet das, was man den persönlichen Stil eines Autors nennen könnte. (Natürlich sollte man dabei immer auf den Unterschied zwischen dem kunstvollen Einsatz der Franse und einem ausgefransten, verfransten Text achten, bei dem kein Webmuster, keine Textur mehr zu erkennen ist und der Stil sich in Beliebigkeit auflöst.) Eine Übersetzung ist dabei nicht mit der Rückseite der Wandteppiche mit ihren verschlungenen Fäden zu vergleichen, wie es Miguel de Cervantes im Don Quijote noch als Bild für schlechte Übertragungen anführt (Teil II, Kapitel 62), doch die losen Fäden der Vorderseite sollte sie sehr wohl wiedergeben.
Die Unregelmäßigkeiten der Handarbeit gehören zu den wichtigsten Eigenschaften des Webstücks und müssen besonders behutsam nachgebildet werden, denn sie machen den individuellen Charakter des Sprachgewebes aus. Darin erlangen sogar die gerissenen und wieder ausgebesserten Fäden eine spezifische Bedeutung. Aufschlussreich dafür ist eine Passage aus Walter Benjamins Übersetzung eines kurzen Textes von J.-M. Sollier (alias Adrienne Monnier) „Die kluge Jungfrau“ („La vierge sage“). Darin heißt es: „Bei der feinen Ausbesserei wird jedes verlorene, gerissene Fädchen von neuen, straffen Fäden aufgenommen und einverleibt in die Gemeinschaft des Gewebes. Es gibt Frauen, die leiden darunter, in geflickten Kleidern sich sehen zu lassen, als wären sie nicht so nobler und kostbarer.“[03]Walter Benjamin: „Gesammelte Schriften. Supplement I: Kleiner Übersetzungen,“ unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem hg. von … Fußnote lesen Das sorgfältige Flicken am Wort macht das Gewebe also wertvoller; je mehr neue Fäden hinzukommen, desto komplexer wird es. Das kunstvoll Überarbeitete ist dem gleichmäßigen Gewebe vorzuziehen. So schreibt auch Friedrich Schlegel 1797 in „Über das Studium der griechischen Poesie“: „die Sprache ist ein Gewebe der feinsten Beziehungen. Sie muß sogar, so scheint es, ihre Eigenheiten haben, um bedeutend und trefflich, zu sein: wenigstens hat man noch keine allgemeine Allerweltsprache, die allen alles wäre, erfinden können.“[04] … Fußnote lesen Gerade in ihren Abweichungen von einem glatten Gewebe vermag die Sprache demnach in die Fasern des von ihr Gemeinten vorzudringen und ihren spezifischen Stil zu entwickeln.
Wenn ein Gewebe aus zwei Fadensystemen besteht, die sich rechtwinklig kreuzen, so lässt sich dies gut auf das Übersetzen übertragen, das mit den Fadensystemen zweier Sprachen arbeitet und sie in ein Verhältnis zueinander setzt. Zwar webt die Übersetzung mit dem Faden ihrer Sprache, doch ein Gespensterfaden der fremden webt im Hintergrund mit und verbindet sich unauflöslich mit ihr. Walter Benjamins Bild in seinem Essay „Die Aufgabe des Übersetzers,“ nach dem Gehalt und Sprache im Original eine Einheit bilden wie „Frucht und Schale,“ während die Übersetzung ihren Gehalt wie einen „Königsmantel in weiten Falten“[05]Walter Benjamin: „Gesammelte Schriften. VI – 1“, hg. v. Tillmann Rexroth, Frankfurt a. M. 1991, S. 15. umgibt, wird dieser Vorstellung eng verwebter Fäden nicht gerecht. Weiter führt hier ein anderes Bild Benjamins aus dem Abschnitt „Schränke“ in „Berliner Kindheit um Neunzehnhundert“:
dann stieß ich auf meine Strümpfe, welche da gehäuft und in althergebrachter Art, gerollt und eingeschlagen, ruhten, so dass jedes Paar das Aussehen einer kleinen Tasche hatte. […] Es war „Das Mitgebrachte“, das ich immer im eingerollten Innern in der Hand hielt und das mich derart in die Tiefe zog. […] nun ging ich daran, „Das Mitgebrachte“ aus seiner wollenen Tasche auszuwickeln. Ich zog es immer näher an mich heran, bis das Bestürzende vollzogen war: „Das Mitgebrachte“ seiner Tasche ganz entwunden, jedoch sie selbst nicht mehr vorhanden war. Nicht oft genug konnte ich so die Probe auf jene rätselhafte Wahrheit machen: dass Form und Inhalt, Hülle und Verhülltes, „Das Mitgebrachte“ und die Tasche eines waren. Eines – und zwar ein Drittes: jener Strumpf, in den sie beide sich verwandelt hatten.[06]https://www.projekt-gutenberg.org/benjamin/berlkind/chap01.html
Ein solcher Strumpf ist auch die Übersetzung im Verhältnis zum Original bzw. der sprachlichen Form zu ihrem Inhalt: Sie selbst muss immer das „Mitgebrachte“ sein, also in ihrer Form das Original mit sich bringen. Es lässt sich kein Inhalt ausrollen, da er die Form selbst ist. Das umgestülpte Original kann so in die Substanz der Übersetzung eingehen.
Doch lassen wir nun das rein Stoffliche, das Web- und Schneiderhandwerk hinter uns und tun einen Schritt weiter in die Biologie. Zunächst zur „Wabe,“ die sich vom Verb „weben“ herleitet, also das Gewebte bzw. Gewebe der Honigbienen ist.

Die Wabe ist ein Wohn- und Lagerungsraum, den die Bienen aus dem eigenen Körper herstellen, und überträgt man diese Bedeutung des Gewebebegriffs auf das Übersetzen, kann man feststellen, dass die Übersetzung die exakte Wabenform des Originals nutzt, das Wachs zu ihrer Herstellung aber wie die Bienen aus dem Körper der eigenen Sprache destillieren muss. Ihre Körpersubstanz geht in die vom Original vorgegebene Form über. Auch hier ist das Ziel eine unauflösliche Einheit.
Aber dringen wir noch tiefer ins Körperliche vor, und zwar zur kleinsten lebenden Einheit, der Zelle. Die Zellen fügen sich zusammen zum Gewebe. Im Körper finden sich die verschiedensten Gewebearten, so etwa das Deck- und Drüsengewebe, das Binde- und Stützgewebe, das Muskel- und Nervengewebe. Junge, noch undifferenzierte Zellen bilden einen Verband und wandeln sich ihrer künftigen Funktion entsprechend um.[07]vgl. https://doi.org/10.1007/978-3-540-93936-8_8

Die Evolution einer Übersetzung könnte man als einen ähnlichen Prozess beschreiben: Einzelne lebende Wortzellen fügen sich allmählich zu einem Verband, der ein differenziertes Ganzes ergeben muss. Es ist ein natürliches Wachstum, das Zelle für Zelle aus sich selbst entsteht. Nur so lässt sich ein lebendiger Sprachkörper aufbauen. Dieses Wachstum sollte jedoch zugleich gesteuert werden, so dass es zu keinem wild wuchernden Gewebe kommt, das unkontrollierte Formen annimmt (und sich so dem natürlichen Körperaufbau entwindet, sich verselbständigt).
Aufschlussreich für das Verhältnis zwischen dem Original und seinen Übersetzungen und Neuübersetzungen ist die Beschaffenheit des Hautgewebes. Der mexikanische Autor Juan Villoro schreibt: „Die Werke, die die Zeit durchwandern, können in anderen Sprachen ihre Haut wechseln.“[08]„El traductor,” in: Juan Villoro: Efectos personales, Barcelona 2001, S. 120. Hier vollzieht sich durch die Übersetzung ein Erneuerungsprozess am Original, der in einer anderen Sprache unter der alten Haut immer wieder neue Sprach- und Bedeutungsschichten freilegt. Goethe schreibt in seiner Abhandlung „Zur Morphologie“ 1807:
die ganze Lebenstätigkeit verlangt eine Hülle, die gegen das äußere rohe Element, es sei Wasser oder Luft oder Licht, sie schütze, ihr zartes Wesen bewahre, damit sie das, was ihrem Innern spezifisch obliegt, vollbringe. Diese Hülle mag nun als Rinde, Haut oder Schale erscheinen, alles was zum Leben hervortreten, alles was lebendig wirken soll, muss eingehüllt sein. Und so gehört auch alles, was nach außen gekehrt ist, nach und nach frühzeitig dem Tode, der Verwesung an. Die Rinden der Bäume, die Häute der Insekten, die Haare und Federn der Tiere, selbst die Oberhaut des Menschen sind ewig sich absondernde, abgestoßene, dem Unleben hingegebene Hüllen, hinter denen immer neue Hüllen sich bilden, unter welchen sodann, oberflächlicher oder tiefer, das Leben sein schaffendes Gewebe hervorbringt.[09] … Fußnote lesen
Die Übersetzung nähert sich dem Original zwar von außen, ist aber kein „rohes“ Element, sondern ein äußerst subtiles. Sie bildet idealerweise noch die feinsten Falten und Unebenheiten seiner Oberfläche ab, bis sie sich wie eine Haut darüberlegen kann. Je enger ihr Kontakt mit seiner sprachlichen Form ist, desto organischer der Zusammenhalt von Übersetzung und Original, bis sie direkt aus ihm herausgewachsen zu sein scheint. Gelingt dieses Zusammenwachsen, wird sie ein lebendiges Gewebe bleiben (und nicht umsonst war ein beliebtes Reimwort für das „Weben“ stets das „Leben“).
Der Begriff des Gewebes hat uns vom Kleid zum Stoff selbst geführt und vom unbelebten Stoff zum belebten Stoff des Zellgewebes, das sich stetig erneuert und wie die Haut untrennbar zu seinem Körper gehört. So wird das Übersetzen vom Gewebtem zum wachsenden Gewebe, das direkt aus der Sprachform des Originals destilliert werden muss und als lebendiger Organismus sein eigenes Leben führt: von der Wortzelle zum lebendigen Text.
| ↑01 | https://www.dwds.de/wb/dwb/wortgewebe |
|---|---|
| ↑02 | Walter Benjamin: „Gesammelte Schriften. VI,“ hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M. 1985, S. 614, siehe auch: https://www.projekt-gutenberg.org/benjamin/selbstze/chap006.html |
| ↑03 | Walter Benjamin: „Gesammelte Schriften. Supplement I: Kleiner Übersetzungen,“ unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem hg. von Rolf Tiedemann und Herrmann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M. 1999, S. 53. |
| ↑04 | http://www.zeno.org/Literatur/M/Schlegel,+Friedrich/%C3%84sthetische+und+politische+Schriften/%C3%9Cber+das+Studium+der+griechischen+Poesie/%C3%9Cber+das+Studium+der+griechischen+Poesie |
| ↑05 | Walter Benjamin: „Gesammelte Schriften. VI – 1“, hg. v. Tillmann Rexroth, Frankfurt a. M. 1991, S. 15. |
| ↑06 | https://www.projekt-gutenberg.org/benjamin/berlkind/chap01.html |
| ↑07 | vgl. https://doi.org/10.1007/978-3-540-93936-8_8 |
| ↑08 | „El traductor,” in: Juan Villoro: Efectos personales, Barcelona 2001, S. 120. |
| ↑09 | http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Naturwissenschaftliche+Schriften/Morphologie/Die+Absicht+eingeleitet#:~:text=Diese%20H%C3%BClle%20mag%20nun%20als,dem%20Tode%2C%20der%20Verwesung%20an |