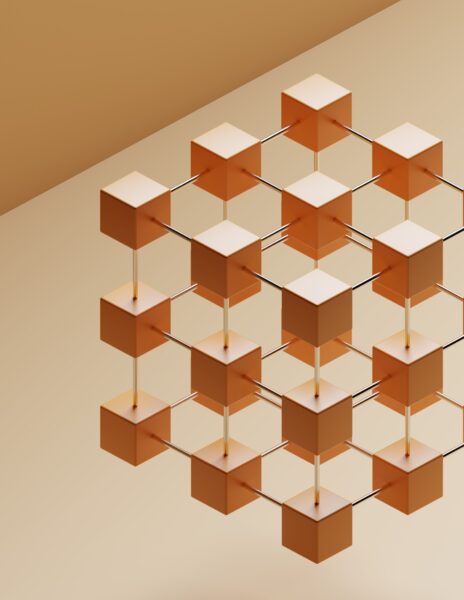Streifzüge durch Sarandīb
Es lohnt sich, sich von der zielgerichteten Suche nach dem passenden Wort, dem richtigen Klang, dem treffenden Bild zu lösen und im Halbbewussten zu fischen, wo das Prinzip der Serendipität als Zusammenspiel von Zufall und Scharfsinn herrscht. Sie kann zu einer ursprünglich nicht beabsichtigten, aber bedeutenden Entdeckung führen.
Ein Wunder von vielen:
eine kleine und flüchtige Wolke,
aber sie kann den großen und harten Mond verschwinden lassen
Wisława Szymborska: Jahrmarkt der Wunder. Aus dem Polnischen übertragen von Karl Dedecius.
Wenn uns jemand danach fragt, woher unser Interesse an der Tätigkeit rührt, mit der wir die Tage verbringen, an dem Gebiet, auf dem wir uns herumtreiben, dessen Besonderheiten uns umtreiben, springen viele von uns weit in die Vergangenheit zurück und sagen: „Schon als Kind …“ So oft begegnet man dieser Wendung, dass einen der Argwohn beschleicht, hier könnte es sich vor allem um eine Konvention der Selbstdarstellung handeln. Das stimmt vielleicht sogar, ist aber nicht entscheidend. Denn im Grunde ist es ja naheliegend, in unsere Urzeit zurückzuspringen, wenn wir schon nach den Ursprüngen bestimmter Aspekte unseres Lebens gefragt werden. Auch mir wird manchmal die Frage gestellt, warum ich angefangen habe, Literatur zu übersetzen, und das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass ich schon immer gerne über Wiesen und durch Wälder gezogen bin.

Die Budaer Berge in den achtziger Jahren eigneten sich gut für solche Streifzüge. Der Wald war nicht weit und die ganze Gegend viel weniger dicht bebaut als heute. Auf großen, verwilderten Grundstücken standen verlassene Gebäude, Hütten oder Villen, die wir oft aufsuchten. Am Vormittag waren wir Schüler, am Nachmittag Stromer. So nannten wir uns nicht und auch die nicht, die wir manchmal in den verlassenen Häusern antrafen. Wenn sie da waren, zogen wir weiter, ihr Nutzungsrecht war gewichtiger als das unsere, das spürten wir. Das und vieles mehr lernten wir beim Stromern, lasen es in den Spuren, die wir fanden.

Als mir vor ein paar Jahren das Wort sérendipité zum ersten Mal begegnet ist, verknüpfte es sich für mich mit diesen Tagen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, warum, aber als ich später das Buch Sérendipité[01]Sylvie Catellin, Sérendipité, Paris 2014. von Sylvie Catellin las, stieß ich gleich im Titel des Vorworts auf eine mögliche Erklärung: Un mot qui libère. Ja, dieses Wort hat etwas Befreiendes an sich. Nun müssten wir nur noch klären, was es eigentlich bedeutet. Es fällt meist im Zusammenhang mit der Entdeckung von Penicillin, den Röntgenstrahlen oder auch dem Klettverschluss, allerdings folgt nicht selten eine Definition, die so sehr hinkt wie das Kamel in der Geschichte Die drei Prinzen von Serendip, auf die ich später noch zurückkomme. So zum Beispiel im Duden. Im vergangenen Herbst entdeckte ich auf der Website des Wörterbuchs unter den neu aufgenommenen Wörtern endlich die deutsche Entsprechung. Dort steht: „Serendipität: (Prinzip der) Zufälligkeit einer ursprünglich nicht angestrebten, aber bedeutenden Entdeckung; auch die zufällige Entdeckung selbst.“ Das wäre an sich nicht falsch, nur ist es unvollständig. Um besser zu erfassen, worum es eigentlich geht, hilft auch hier ein Blick auf den Ursprung, diesmal den etymologischen.
Das Wort Serendipity wurde von Horace Walpole, dem 4. Earl of Orford, geprägt, schriftlich verwendete er es zum ersten Mal am 28. Januar 1754 in einem Brief an seinen Freund und entfernten Verwandten Horace Mann, einem Diplomaten am florentinischen Hof. In diesem berichtete er von einer interessanten Beobachtung, die er kurz zuvor gemacht hatte und die ihn an die Geschichte The Three Princes of Serendip erinnerte.[02]Vgl. The Letters of Horace Walpole, Earl of Orford – Volume 2. Letter 90. To Sir Horace Mann. Arlington Street, Jan. 28, 1754, siehe Gutenberg, … Fußnote lesen In Anlehnung an diese bezeichnete er den Prozess seiner Beobachtung samt dessen Voraussetzungen als einen Fall von serendipity.
Der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist.
Serendip oder Sarandīb war eine alte arabische Bezeichnung für das heutige Sri Lanka. Die Geschichte handelt von den drei Söhnen König Jafars, die dieser von den weisesten Männern des Landes erziehen ließ und anschließend auf Reisen schickte, damit sie sich auch das Wissen aneigneten, das durch Bücher nicht zu vermitteln war und sie auf diese Art ihre Ausbildung vervollkommneten. Die jungen Männer machten unterwegs allerlei Entdeckungen, by accidents and sagacity, wie Walpole feststellt. Er nennt also bereits in diesem Brief die Grundvoraussetzungen für das Phänomen der Serendipität: Zufall und Scharfsinn. Mit der Benennung dieser beiden Faktoren nahm Walpole eine Beobachtung vorweg, die Louis Pasteur genau hundert Jahre später machte: Der Zufall trifft nur einen vorbereiteten Geist. Walpoles flüchtige Formulierung und diese einfachen und klaren Worte Pasteurs bringen uns dem Verständnis der Serendipität schon recht nah, trotzdem sollten wir uns die Geschichte ansehen, auf die sich Walpole bezieht. Die Prinzen sind schon eine Weile unterwegs, als sie einen Kameltreiber[03]Horace Walpoles Erinnerung hat das Kamel in ein in seiner Heimat eher anzutreffendes Tier, den Esel, verwandelt, daher kursiert auch diese Version. treffen, der sie fragt, ob sie nicht zufällig ein verirrtes Kamel gesehen hätten. Das Kamel selbst hatten sie zwar nicht gesehen, aber Spuren, die – zumindest für ihre im Spurenlesen geschulten Augen – eindeutig auf eben dieses Tier hindeuteten. Der Älteste fragt den Kameltreiber, ob das Kamel nicht auf einem Auge blind sei, der Mittlere, ob ihm nicht ein Zahn fehle und der Jüngste, ob es nicht hinke. All diese Eigenschaften treffen auf das Tier zu, weshalb der Kameltreiber dann auch glaubt, die drei hätten es tatsächlich gesehen. Was sie aber gesehen haben, war lediglich, dass das Gras nur auf der einen Seite des Weges kurz gefressen war, obwohl es auf der anderen Seite frischer aussah, und dass kleine Grasbüschel, von der Größe eines Kamelzahns, mitten aus den abgeweideten Stellen ragten. Die Vermutung über das Hinken des Tieres hatten ihnen die Hufspuren eingegeben.
Da es sich bei der Serendipität um einen komplexen Vorgang handelt, bei dem verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden müssen, die zeitlich sehr weit auseinanderliegen können, ist es tatsächlich nicht einfach, eine klare Definition zu geben. Am ehesten könnte man es aber wohl als das Zusammenspiel von Scharfsinn und Zufall bezeichnen, das zu einer ursprünglich nicht beabsichtigten, aber bedeutenden Entdeckung führen kann.

Den Begriff der Serendipität verdanken wir also Horace Walpole, doch das Phänomen, das er beschreibt, ist natürlich kein neues. Das Motiv eines Menschen, der fortwährend seine Sinne schärft und dadurch irgendwann verborgene Zusammenhänge erkennt, ist aus den Erzählungen vieler Kulturen bekannt. Das Märchen von den drei Prinzen aus Serendip, das Walpole gelesen hatte, ist auch nur eine Version einer Geschichte, die in verschiedenen Ländern des asiatischen Raumes bereits seit Jahrhunderten erzählt wurde. In Europa war sie ab dem 16. Jahrhundert bekannt, nachdem Christoforo Armeno sie aus dem Persischen ins Italienische übersetzt hatte.[04]Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo, per opra die M. Christoforo Armeno, dalla persiana nell’italiana lingua trapportato, … Fußnote lesen In der Literatur begegnen wir diesem Motiv in Voltaires Zadig bereits 1747, später bei Balzac, Poe, Conan Doyle oder Wilkie Collins, dem Verfasser von The Moonstone, der ersten englischen detective novel. Auch in späteren Kriminalromanen, einem Genre, dessen Grundzutat ja Spurenlesen ist, spielen Serendipitätsmomente eine entscheidende Rolle.
Womit wir nun beim Übersetzen wären. Sehen wir uns zunächst an, wo das Übersetzen stattfindet. Das Bild des Übersetzers als Brückenbauer habe ich, ehrlich gesagt, nie verstanden. Eine Brücke wird ja zwischen zwei konkreten Punkten in der Landschaft errichtet, und selbst wenn wir dem Übersetzer zugestehen, dass er die jeweiligen Punkte bestimmt, sagen wir, als Punkt A seine Interpretation des Ausgangstextes wählt und als Punkt B die Vision, die er von dem Text in der Zielsprache hat, erscheint mir die Metapher zu wenig mit dem verbunden, wofür sie stehen soll. Ohne hier auf die Schwierigkeiten bei der Bestimmung dieser beiden Punkte einzugehen, können wir feststellen, dass dieses Bild eine eher technizistische Auffassung vom Übersetzen widerspiegelt, die von einer klaren Trennung zwischen diesseits und jenseits durch – ja, wodurch eigentlich? – ausgeht. Wofür der Bach, Fluss, Strom steht, über den die Brücke errichtet werden soll, war mir auch nie klar. Im Grunde fehlt mir für alles an diesem Bild die Entsprechung, auch für die Ufer.
Für mich waren die beiden Sprachen – zunächst die Mutter- und die Vatersprache, aber dieses Verständnis übertrug sich später auf jede andere Situation, in der es darum ging, zwischen zwei Sprachen zu vermitteln – nie so klar voneinander getrennt wie zwei Ufer, sie lagen vielmehr in verschiedenen Bereichen desselben Raumes. Wobei hier Raum ein Gelände ohne klar erkennbare Grenzen meint. Die eine Sprache eher hier, die andere eher da und dazwischen viel Luft. Dunst und Licht. Und Gras. Bäume, Blumen, Gestrüpp. Ein riesiges Gebiet voller Spuren, das erkundet werden will, jeden Tag aufs Neue. Denn ebenso wie die Welt in diesem Bereich des Raumes und in jenem, wie die Bedeutung der Wörter hier und auch da, verändert sich das Dazwischen fortwährend. In diesem mittleren Streifen des gemeinsamen Lebensraumes der beiden Sprachen entsteht für mich die Übersetzung. Bei der Arbeit bewege ich mich über das gesamte Gebiet, durchstreife das vom Originaltext vorgegebene Gelände, aber was ich dort sehe und vor allem höre, hängt auch davon ab, woran ich meine Wahrnehmung geschult, meine Sinne geschärft habe. In der Zeit, bevor ich auch nur eine Zeile des entsprechenden Textes übersetzt habe, aber auch während der Tage, Monate der Arbeit daran. Eine auf der Straße nur halbbewusst wahrgenommene Bemerkung kann einen Einfluss darauf haben, für welche von zwei möglichen Varianten ich mich eine Woche später bei der Übersetzung eines Wortes entscheide. Überhaupt werden viele Entscheidungen, durch die sich am Ende der charakteristische Ton einer Übersetzung ergibt, in dem Bereich gefällt, in dem das Bewusste und das Unbewusste ineinander übergehen, im Bereich des tacit knowledge, des impliziten Wissens, wie es der Philosoph Michael Polanyi nannte.
Jeder Übersetzer kennt diese Momente, diese, ja, wie wollen wir sie nennen? Ein entsprechendes Adjektiv gibt es noch nicht, doch erscheint mir durch die offensichtliche Verwandtschaft mit dem Wort magisch, die Bildung serendipisch als treffend. Die großen serendipischen Momente, in denen man auf einmal die Lösung für eine grundlegende, den gesamten Text betreffende Frage findet, aber auch die nicht minder wichtigen Mini- oder Mikromomente, in denen sich das Wort, das einem schon die ganze Zeit auf der Zunge lag, durch irgendeinen Impuls plötzlich von dieser löst und in die Fingerspitzen fließt, um zu Papier gebracht zu werden. Man hat kaum Einfluss darauf, ob sich diese Momente einstellen oder nicht, da sie jedoch mit zunehmender Übersetzungs- und Lebenserfahrung häufiger auftauchen, kann man davon ausgehen, dass sie sich ab und an durchaus einladen lassen. Und je öfter man es versucht, desto klarer spürt man, auf welche Form von Einladung sie besonders gern eingehen. Ob man in einem klassischen, gedruckten Wörterbuch blättert, sich einen Bildband ansieht, eine Unregelmäßigkeit in der Wand betrachtet oder vom Schreibtisch aufsteht, um für eine Weile etwas anderes zu machen, ist nicht entscheidend. Worum es eigentlich geht, ist die Loslösung von der zielgerichteten Suche, die Verlagerung der Aufmerksamkeit, um die passenden Wörter, Worte und Klänge aus dem Dämmer des eigenen Halbbewussten zu fischen. Man nähert sich dem Problem über einen Umweg, von der Seite, nicht frontal, wechselt die Perspektive und atmet statt der abgestandenen Luft der gedanklichen Anstrengung eine frischere, sauerstoffreichere.
Diese Momente des Findens sind vielleicht eine der Hauptquellen für den Glanz, den die Augen von Übersetzern bekommen, wenn sie von ihrer Arbeit sprechen. Denn, wie gesagt, jeder kennt sie, auch wenn er nie das Bedürfnis verspürt hat, sie zu benennen. Und doch ist es eine Bereicherung, dass der Begriff der Serendipität nun allmählich auch in der deutschen Alltagssprache ankommt. Denn die Benennung eines Phänomens macht auf dessen Existenz aufmerksam, verleiht ihm Legitimität und schafft somit ein Gegengewicht zum Zeitdruck, der sich unter den Faktoren, die unsere Arbeit beeinflussen, so gern in den Vordergrund drängt. Dieses lange und doch leichte Wort erinnert nicht nur an die klanglich verwandte Serenität, es schenkt einem auch etwas von deren Beschwingtheit, lockt hinaus und ermuntert herumzuziehen und sich umzusehen.
| ↑01 | Sylvie Catellin, Sérendipité, Paris 2014. |
|---|---|
| ↑02 | Vgl. The Letters of Horace Walpole, Earl of Orford – Volume 2. Letter 90. To Sir Horace Mann. Arlington Street, Jan. 28, 1754, siehe Gutenberg, letzter Zugriff: 17.05.2021. |
| ↑03 | Horace Walpoles Erinnerung hat das Kamel in ein in seiner Heimat eher anzutreffendes Tier, den Esel, verwandelt, daher kursiert auch diese Version. |
| ↑04 | Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo, per opra die M. Christoforo Armeno, dalla persiana nell’italiana lingua trapportato, M. Tramezzino Venedig 1557. |