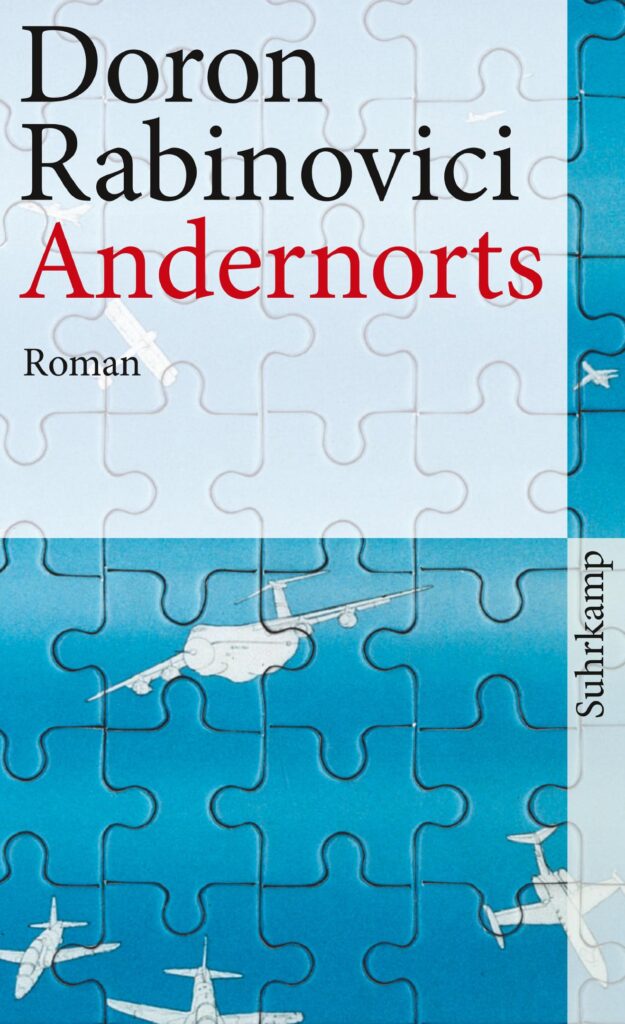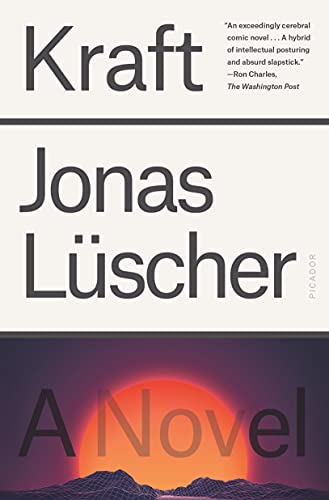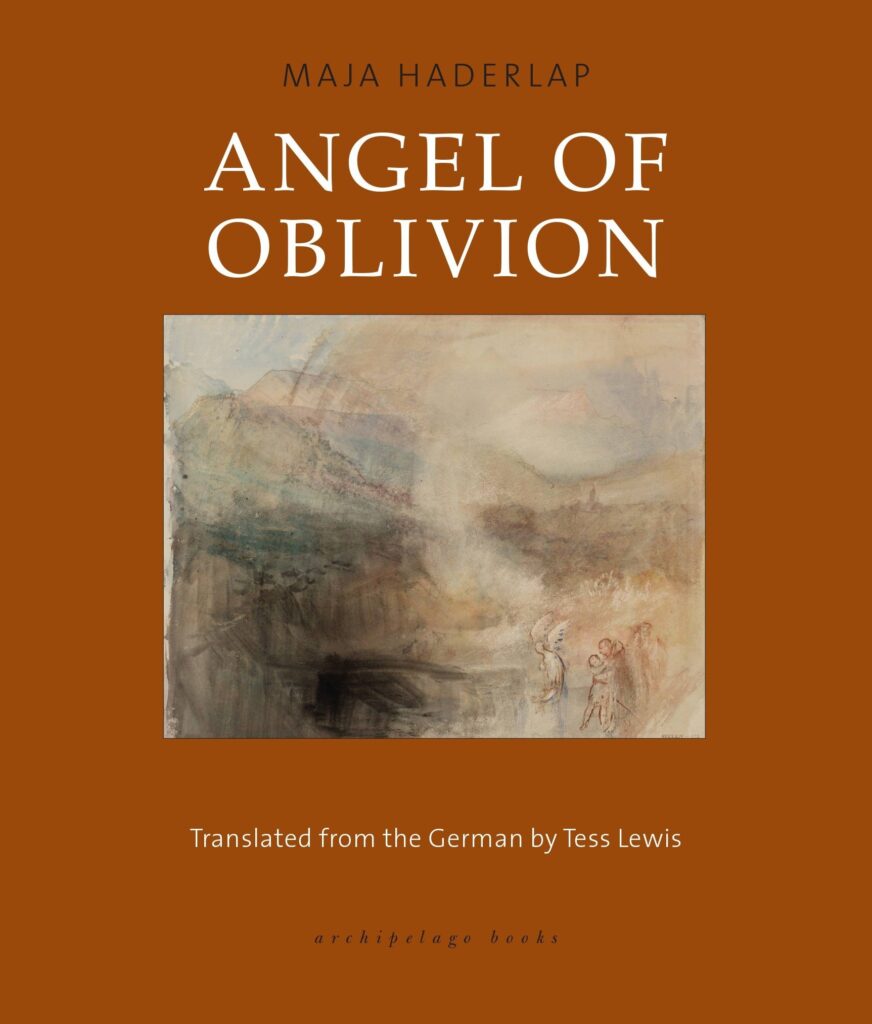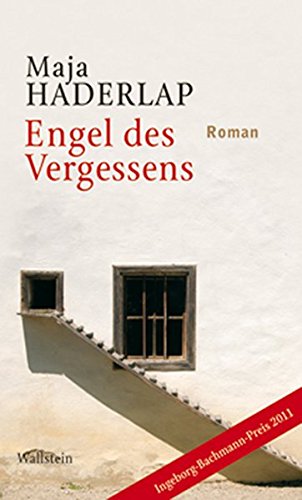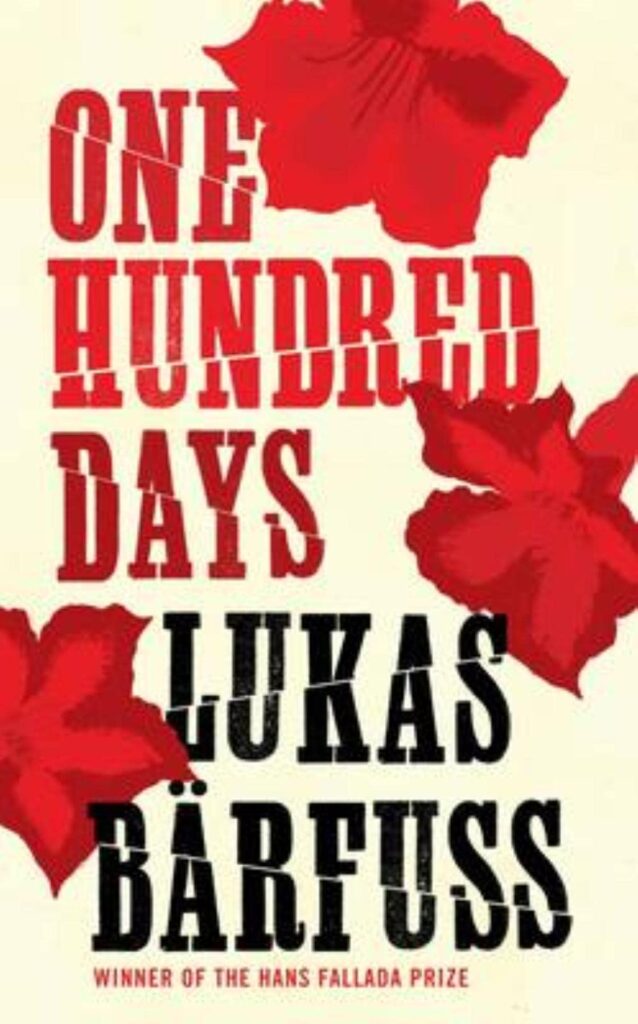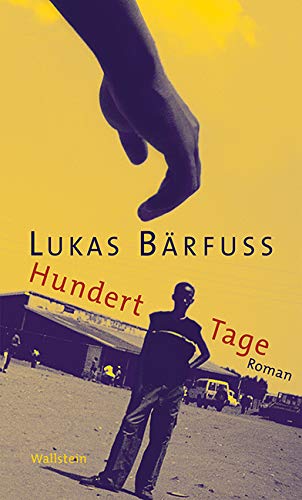Die Kunst des Verrats: Übersetzen in einer Zeit des Misstrauens
Was bedeutet es, treu zu sein, wenn man mehreren Herren dient? Tess Lewis untersucht die umstrittene Idee der Treue anhand von Beispielen aus ihren Übersetzungen von Walter Benjamin, Maja Haderlap, Jonas Lüscher und anderen.
Im Frühjahr 1970 lud der Übersetzungsausschuss des amerikanischen PEN zu einer einwöchigen Tagung über „Die Welt der Übersetzung“ nach New York City ein. Sie brachte Dutzende von angesehenen Übersetzer·innen, Autor·innen und Lyriker·innen zusammen, darunter Gregory Rabassa, Irving Howe, Isaac Bashevis Singer und Muriel Rukeyser. Das Manifest des Ausschusses begann mit einem Aufruf zum Handeln: „For too long [translators] have been the lost children in the enchanted forest of literature. Their names are usually forgotten, they are grotesquely underpaid, and their services, however skillfully rendered, are regarded with the slightly patronizing and pitying respect formerly reserved for junior housemaids.“[01]P.E.N. Translation Committee, Manifesto on Translation. („Allzu lange waren die Übersetzer die verlorenen Kinder im verwunschenen Wald der … Fußnote lesen In den seitdem vergangenen fünfzig Jahren hat sich in der englischsprachigen Welt des Übersetzens einiges getan: Die Namen der Übersetzer·innen erscheinen immer häufiger auf dem Schutzumschlag ‒ oft sogar auf dem Cover und nicht nur kleingedruckt auf der hinteren Umschlagklappe ‒, und wenn die Kritiker·innen und Rezensent·innen den vorzüglichen oder innovativen Stil dieses ausländischen Autors oder jener ausländischen Autorin rühmen, vergessen sie nicht mehr ganz so schnell, dass die englische Version, genau genommen, aus den Worten einer dritten Person besteht. Für die größten amerikanischen Verlagshäuser rangiert ausländische Belletristik weiterhin nur unter ‘Ferner liefen’, aber in den letzten zwanzig Jahren sind in Großbritannien und den Vereinigten Staaten über ein Dutzend Kleinverlage gegründet worden, die ausschließlich oder in erster Linie übersetzte Werke veröffentlichen, und internationale Preise, die Übersetzungen auszeichnen, haben an Prestige und Dotierung gewonnen. Auch wenn der Berufsstand immer noch grotesk unterbezahlt ist, werden den Übersetzer·innen Tantiemen etwas weniger ungern zugestanden als früher, und sie können sich um mehr Stipendien und Förderungen bewerben als vielleicht je zuvor.
Der Übersetzer·innen entgegengebrachte Respekt ist allgemein gestiegen, was hoffentlich auch für junge Hausangestellte gilt. Bei Bewerbungen um Professuren werden Übersetzungen an manchen Universitäten beispielsweise als Veröffentlichungen anerkannt. Und obwohl übersetzte Werke nur einen winzigen Bruchteil der Bücher ausmachen, die sie rezensiert, pflegt die New York Times eine eigene Website namens Globetrotting mit „Sneak-Previews“ für 75 bis 100 übersetzte Bücher, nach denen man jedes Jahr Ausschau halten solle. Trotzdem handelt es sich bei dem Respekt, der Übersetzer·innen gezollt wird, um eine zwiespältige Angelegenheit. Er mag weniger von Mitleid und Herablassung geprägt sein, ist aber immer noch mit dem Misstrauen behaftet, das mit der Fetischisierung der vollkommenen Übersetzung untrennbar verbunden ist. Esther Allen hat das Dilemma der Übersetzer·innen auf den Punkt gebracht: „conventional wisdom both disparages them for being mere copyists and mistrusts them for not being mere copyists“.[02]Esther Allen und Susan Bernofsky (Hgg.), In Translation. Translators on Their Work and What It Means, New York: Columbia UP 2013, S. 98. („Die … Fußnote lesen Ganz abgesehen von der Tatsache, dass genaue Äquivalenz auf eine Kopie hinausliefe und keine Übersetzung wäre, gibt es nie nur eine definitive Übersetzung eines Werks. Natürlich sind manche Übersetzungen besser als andere, und manche sind schauderhaft schlecht.
Jede Sprache ist eine eigene Welt und ist mindestens seit der Zerstörung des Turms zu Babel eine gewesen. Sie mag einzelne Gebiete oder Wetterlagen mit anderen teilen, ist aber nicht identisch mit einer anderen und kann das auch nie sein. Wie Emily Apter in ihrer Einführung zum Dictionary of Untranslatables betonte: „Nothing is exactly the same in one language as in another, so the failure of translation is always necessary and absolute. Apart from its neglect of the fact that some pretty good equivalencies are available, this proposition rests on a mystification, on a dream of perfection we cannot even want, let alone have.“[03]Barbara Cassin, Emily Apter und Michael Wood (Hgg.), Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon, Princeton: Princeton UP 2014, S. xiv. … Fußnote lesen
Das zwangsläufige und absolute Scheitern des Übersetzens dient oft als Vorwand, um übersetzte Literatur abzutun, die eigentlich ja gar kein Werk der jeweiligen Autorin sei, oder rechtfertigt die eigene intellektuelle Borniertheit und Bequemlichkeit, in Wahrheit ist es aber eine Hauptquelle seines Reichtums und Werts. Jede Übersetzung beruht auf einer Interpretation. Die Übersetzerin bietet ihren ganzen Hintergrund auf, ihre Lebenserfahrungen, ihre Reisen und ihre Lesesozialisation, ihre Intuition und ihr Vokabular, das von dem deutschen Ausdruck „Wortschatz“ so wunderbar eingefangen wird. Kurz: Ihre gesamte „Autographie“ kommt ins Spiel, wie Michael Hofmann es auf den Punkt brachte.[04]„This is translation not quite as autobiography but maybe as ‘autography’: turning out my pockets, Schwitters-style, a bus ticket, a scrap of … Fußnote lesen
„Der Verrat wurzelt in den Wörtern.“
Auf die Gefahr hin, den Eindruck zu erwecken, ich wolle die Schuld an verunglückten oder veruntreuten Stellen in meinen eigenen Übersetzungen in andere Schuhe schieben, möchte ich noch über Emily Apter hinausgehen und die Aussage wagen, dass das Unterfangen der Überführung eines Texts aus einer Sprache in eine andere von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist ‒ nicht nur, weil die Sprachen nicht zueinander passen, sondern auch, weil schon in den grundlegendsten Elementen unseres Mediums der Verrat wurzelt: in den Wörtern. Wörter sind wankelmütige Dinge, ein einziges Wort kann zahllose Bedeutungen bergen, auch widersprüchliche wie im Fall von „Untiefe“ oder „aufheben“. Dann gibt es Homophone, die wie hörbare Schiebetüren funktionieren. Außerdem wachsen Wörtern im Lauf des Lebens jeder Sprecherin persönliche Assoziationen und Nuancen zu. Und damit nicht genug: Die Bedeutungen von Wörtern können sich im Lauf der Zeit und nach Maßgabe des Kontexts ändern. Bis ins 18. Jahrhundert war laut dem Oxford English Dictionary das Wort „nice“ etwa fast ausschließlich abwertend, es hatte die Bedeutungen närrisch, grotesk, schamlos, ausschweifend, faul und prahlerisch, aber auch elegant, genau und penibel. In den letzten dreihundert Jahren hat sich sein Bedeutungsspektrum jedoch um 180 Grad gedreht und bezeichnet heute lobenswerte Eigenschaften wie respektabel, kultiviert, tugendhaft, anständig, angenehm, liebenswürdig, attraktiv und so weiter.
Andernorts, der Roman des österreichischen Autors Doron Rabinovici, den ich vor knapp zehn Jahren unter dem Titel Elsewhere übersetzt habe, bietet amüsanten Anschauungsunterricht für die heikle Schwankungsbreite von Wörtern. Sein Protagonist Ethan Rosen ist ein brillanter Soziologe, in Tel Aviv als Kind von Holocaust-Überlebenden zur Welt gekommen, aber in Wien aufgewachsen. Er beherrscht ein halbes Dutzend Sprachen und schreibt wissenschaftliche Aufsätze und polemische Leitartikel auf beiden Seiten der Verwerfungslinien zwischen der israelischen und der europäischen Kultur. Er ist ein Oppositioneller aus Prinzip, ein umgekehrtes Chamäleon, nie israelischer als in Österreich und nie österreichischer als in Tel Aviv.
Als seine Kommentare in einer israelischen Zeitung, in denen er Gesellschaftsreisen zu KZ-Gedenkstätten geißelt, von einem universitären Rivalen in einer österreichischen Zeitung zitiert werden, der sie nur einem weithin bekannten israelischen Intellektuellen zuschreibt, erkennt Ethan seinen eigenen Text nicht wieder und veröffentlicht eine geharnischte Reaktion. Die Kontroverse läuft aus dem Ruder. (Es gibt eine amüsante Nebenhandlung um einen ultraorthodoxen Rabbiner, der aus der DNS eines angeblichen Nachfahren von David und Salomon aus dem Hause Juda vergeblich einen Messias zu klonen versucht; auch dieser Versuch, ein Original in ein Original umzucodieren, ist eine sinnige Veranschaulichung der Aufgabe des Übersetzens.)
In Rabinovicis Roman ebenso wie in der Alltagserfahrung und besonders in der Politik ist „Wahrheit“ relativ und unergründlich. Wie jede Bedeutung ändert sie sich, je nachdem wer sie ausspricht und wo und wann sie ausgesprochen wird. Sowohl Wahrheit als auch Bedeutung sind im Vollsinn dieser Worte immer andernorts, auch wenn mehr oder weniger zutreffende Versionen von ihnen immer gerade noch in Reichweite zu liegen scheinen.
Ein ständiges Bemühen, das instabile Wesen namens Übersetzung näher zu bestimmen, besteht in der Suche nach Metaphern oder Analogien. Dieses erkenntniskritische Gesellschaftsspiel hat eine lange und immer noch wachsende Liste hervorgebracht. Die Beispiele sind aufschlussreich und doch beschränkt. Da haben wir den Übersetzer als einen Hund an einer kurzen oder langen Leine und die Übersetzerin als Musikerin, die eine Partitur interpretiert, oder als Komponistin, die ein Werk für ein anderes Instrument transponiert. Der Übersetzer wird auch mit einem Landschaftsmaler verglichen, der sich einer anderen Farbpalette bedient, mit einem Koch, der ein bestimmtes Gericht mit Ersatzzutaten anrichtet, einer Schauspielerin, die in eine Rolle schlüpft, einem Boten, der die Nachricht entstellt, einer Bauchrednerin, ja selbst mit einer schlichten Glasscheibe. Auch für den Akt des Übersetzens gibt es Metaphern, etwa den Aal, der in einem Teich gefangen und in einem anderen ausgesetzt wird, die Arbeit in einem Spiegelkabinett oder den Kuss durch einen Schleier.
Diese Metaphern erfassen einzelne Aspekte der Metamorphosen beim Übersetzen, aber nie das ganze Spektrum der Instabilität und Variabilität dieser Kunst. Als Pendant oder Ergänzung möchte ich die Photographie als emblematisch für die Übersetzung vorschlagen. Indem sie ihr Motiv in der Zeit und in einem konkreten Medium (Film oder Leinwand) verankert, ist die Photographie eine in spannungsvoller Schwebe gehaltene Art Übersetzung. Auf einer Photographie wird ebenso wie in einer Übersetzung ein flüchtiges und vielgestaltiges Ganzes in zwei Dimensionen fixiert, an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit, aus der Perspektive der Betrachterin aber in einer sich ändernden Gegenwart. Eine Übersetzung ist genauso wie eine Photographie ein Abbild des Originals, gewiss, dieses Original ‒ der Text ‒ wird aber aus einem bestimmten Winkel wahrgenommen: vor dem kulturellen und persönlichen Hintergrund der Übersetzerin, ihrer Lektüre und Bildung; und es wird in einem bestimmten Licht ‒ der Originalsprache und des Originalkontexts ‒ gesehen und dann in einem anderen wiedergegeben, mit einer bestimmten Verschlusszeit, in Farbe oder Schwarzweiß. Der Übersetzung eignet ebenso wie der Photographie ein Element des Suspense ‒ im Sinn einer spannungsvollen Erwartung ebenso wie einer Ungewissheit ‒ bei der Reise einer Idee, eines Ganzen, einer Vision zwischen zwei Medien und, wichtiger noch, der Verwandlung von etwas Übersinnlichem in sinnlich Konkretes. Damit endet die Reise aber noch nicht, denn die Leser·innen bringen ebenso wie die Betrachter·innen ihre Vorannahmen mit und interpretieren diesen entsprechend.
„Können wir Übersetzungen vertrauen? Und warum sollten wir?“
Nachdem ich Sie auf die instabilen Fundamente der Übersetzung gelockt und Ihnen die Unzuverlässigkeit von deren Baumaterialien gezeigt habe, kann ich Ihnen hoffentlich wieder einen festeren Stand verschaffen, indem ich den entscheidenden Fragen nachgehe: Können wir Übersetzungen vertrauen? Und warum sollten wir?
In einer meiner demnächst erscheinenden Übersetzungen gibt es eine Passage, die die Zwickmühle der Übersetzerin bündig zusammenfasst. Sie stammt aus der Sammlung von Mikrofiktionen der jungen Schweizer Schriftstellerin Judith Keller mit dem Titel Die Fragwürdigen. Keller vertieft sich in ihren Kurztexten in die Aporien der Sprache, indem sie idiomatische Wendungen wörtlich nimmt, die vielfältigen Bedeutungen der Wörter entfaltet und Erwartungen frappiert. Sie schärft den Blick für einzelne Wörter, schält die Schichten an Vorstellungen und Unterstellungen ab, die sie umwuchern, und öffnet damit metaphysische Falltüren. Hier nimmt sie es mit der Treue auf:
Treue
Indem sie ihm treu ist, befürchtet sie, sich nicht treu zu sein. Sie weiss nicht, ob sie sich treu sein möchte. Es ist ihr nicht klar, wem sie dann treu sein müsste.[05]Judith Keller, Die Fragwürdigen, Luzern: Der gesunde Menschenversand 2017 (edition spoken script 23), S. 26. „Fidelity. In being true to him, … Fußnote lesen
Die erste Frage, die sich bei der endlosen ‒ mal nervtötenden und mal fruchtbaren ‒ Debatte um die Treue der Übersetzung stellt, lautet: „Wem oder was treu?“ Der Originalsprache, der Ziel- oder Ankunftssprache, der Stimme der Autorin mit all ihren Eigentümlichkeiten und Idiosynkrasien oder deren Fahlen, der Interpretation der Übersetzerin oder ihrem Idiolekt? Bleibt sie zu dicht am Original, sozusagen zu wörtlich, kann die Übersetzerin kaum zu ihrem Verständnis oder ihrer Interpretation des Originals stehen. Gibt sie sich aber zu sehr ihrer eigenen „Autographie“ hin, erweist sie dem Original unweigerlich einen Bärendienst. Verkompliziert wird das durch die Tatsache, dass manche Autoren es begrüßen, wenn sich ihre Übersetzer einmischen oder einen ‘Betrug nach oben’[06]„Die interessantesten Beispiele übersetzerischer ‚Transfiguration‘ sind sowohl aus methodischer als auch aus geistesgeschichtlicher Sicht … Fußnote lesen begehen. Borges, der sich im Altenglischen und in der angelsächsischen Dichtung gut auskannte, erklärte seinem Übersetzer: „Simplify me. Modify me. Make me stark. My language often embarrasses me. It’s too youthful, too Latinate. […] I want the power of Cynewulf, Beowulf, Bede. Make me macho and gaucho and skinny.“[07]„Vereinfachen Sie mich. Ändern Sie mich. Machen Sie mich schlicht. Meine Sprache ist mir oft peinlich. Sie ist zu jugendlich, zu romanisch … … Fußnote lesen Trotz seiner großen Vorliebe für die verdichtete, urwüchsige Kraft altenglischer Wörter kannte Borges die Reichtümer, die die doppelte Erbschaft der englischen Sprache ihrem Wort-Schatz vermacht hatte.
Infolge der Invasionen durch Römer, Wikinger und Normannen verfügt das Englische nicht nur über mehr Wörter als das Französische oder das Deutsche ‒ nach manchen Zählungen über doppelt so viele, aber das lässt sich unmöglich genau quantifizieren ‒, es hat auch zwei grundverschiedene Register: die derbe Bodenhaftung der angelsächsischen Wörter und die eher abstrakten romanischen Wörter. Die Spannung zwischen diesen beiden auszuloten und sich innerhalb eines Satzes vom einen zum anderen Register zu bewegen, ist ein nützliches Verfahren, um im Englischen Ironie und Humor zu vermitteln, wofür im Deutschen und im Französischen andere stilistische Mittel bereitstehen. Man nutzt alle Ressourcen, die die eigene Sprache zu bieten hat.
Ich möchte ein paar Beispiele aus meinen Übersetzungen vorstellen, um die Strategien und Ressourcen zu veranschaulichen, die ich verwendet bzw. erschlossen habe, um dem Original und meiner Erfahrung des Originals treu zu bleiben. Ich hoffe, sie können Ihren Glauben an die Vertrauenswürdigkeit von Übersetzer·innen und ihren Werken wiederherstellen, den ich mit meinen einleitenden Bemerkungen vielleicht erschüttert habe.
Fragen von Ton und Syntax
Beim Übersetzen von Jonas Lüschers Roman Kraft, einer Satire auf neoliberale Werte und die Hybris im Silicon Valley habe ich mich sehr stark auf ein abstraktes, intellektuelles Stilregister gestützt. Richard Kraft, der Protagonist, ist ein deutscher Rhetorikprofessor und alternder Reagan-Anhänger, hochverschuldet und unglücklich verheiratet. Vom Glück verlassen, ändert er seine Meinung zur angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, die er ‒ entschieden gegen den Strom ‒ im Deutschland der späten achtziger und neunziger Jahre als den Königsweg verteidigt hat. Trotzdem beteiligt er sich an einem von einem Silicon-Valley-Mogul gesponserten Essaywettbewerb zu der Frage „Weshalb alles, was ist, gut ist, und weshalb wir es dennoch verbessern können“, und ist zuversichtlich, dass er die siegreichen Argumente liefern wird, die den Optimismus in unserer Technologieära unterstützen. Das Preisgeld von einer Million Dollar würde seinen finanziellen und ehelichen Kummer auf einen Schlag aus der Welt schaffen. Lüschers Stil in diesem Roman ist von bewusster, üppiger und komplexer Intellektualität. Seine Sätze bilden Krafts verschlungene Gedankengänge ebenso ab wie die gedanklichen Spitzfindigkeiten, mit denen er die relativ neuen Prinzipien und leisen Zweifel desavouiert, die ihn schon vor der Teilnahme an dem Wettbewerb beschlichen haben.
Die erste Fallgrube des Romans war sein Titel, Kraft. Im Namen des Protagonisten schwingen Stärke, Macht, Energie, Vermögen, Schwung, Vitalität und Männlichkeit mit, und das Buch ist gespickt mit Wortspielen auf die vielen Bedeutungen des Worts. Der Lektor und ich haben lange diskutiert, ob Richard Kraft in der Übersetzung Richard Power heißen sollte. Um Assoziationen mit dem weit bekannteren amerikanischen Romancier Richard Powers zu vermeiden, und weil die Wortspiele auf ‘Kraft’ zu vielfältig waren, um von nur einem englischen Ausdruck wiedergegeben zu werden, sind wir bei dem deutschen Namen geblieben. (Es gibt da, nebenbei bemerkt, eine sehr komische Passage, in der es um Makkaroni mit echtem Schweizer Käse geht, wo wir uns die Anspielung auf Kraft Mac N Cheese lieber verkniffen haben.)
In der folgenden Passage verzweifelt Richard Kraft angesichts seiner Unfähigkeit, eine Antwort zu formulieren:
Es ist nur noch wenig Kraft in ihm, und er hat auf dieser Reise vieles geschluckt, jetzt kann er auch noch den Rest des Weges gehen und sich selbst vollends den Rücken kehren.[08]Jonas Lüscher, Kraft. Roman, München: C.H. Beck 2017, erneut München: btb 2018, S. 228 (Hervorhebungen T.L.).
Eine wörtliche Übersetzung des ersten Hauptsatzes ‒ „There is only a little Kraft left in him“ ‒ wäre unbeholfen gewesen und hätte den Textfluss gestört. Ich habe mich also dafür entschieden, seine Niedergeschlagenheit mit „but a shadow of himself“, „nur noch ein Schatten seiner selbst“ auszudrücken:
Kraft is but a shadow of himself at this point, he’s had to eat a lot of crow on this trip. Now he can see it all through to the end and thus definitively turn his back on his convictions.[09]Ders., Kraft. A Novel, aus dem Deutschen von Tess Lewis, New York: Farrar, Straus and Giroux 2020, S. 206 (Hervorhebungen T.L.).
Ich habe also versucht, die verschmitzte Ironie der deutschen Formulierung mit einem Registerwechsel zwischen dem umgangssprachlichen „eating crow“[10]‚die bittere Pille schlucken‘, ‚Kreide fressen‘ (Anmerkung U.B.). und der leicht formellen ‘Abkehr von seinen Überzeugungen’ einzufangen.
Das nächste kurze Beispiel zeigt, wie Lüschers Sätze Krafts logische Verrenkungen abbilden (und gleich noch ein Wortspiel auf seinen Namen liefern) ‒ die besten dieser Passagen erstrecken sich über Seiten, aber ich beschränke mich auf eine der kürzesten:
Von wegen Kraft weiß, was er zu tun hat. Der Zweifel kommt schneller, als er in der Lage ist, die Euphorie der Nacht in einen konsistenten Gedankengang zu packen. Mühsam versucht er, die nächtliche Empfindung wiederherzustellen, und als ihm das nicht gelingt, probiert er es mit Pragmatismus und System, denn wenn er sich richtig erinnert, erwuchs seine Tatkraft in Mckenzies Zimmer aus genau dieser Richtung.[11]Jonas Lüscher, Kraft. Roman, a.a.O., S. 175 (Hervorhebung T.L.).
Wörtlich übersetzt:
Fat chance Kraft knows what he has to do. Doubts come faster than he is able to marshal the previous night’s euphoria into a consistent train of thought. He laboriously tries to recover last night’s feeling and when that proves impossible, he attempts to do it through pragmatism and systematic thought because, if he remembers correctly, the energy that filled him in Mckenzie’s room came from exactly that source.
Das ist zu weitschweifig und sperrig. Ich habe die Sätze umgestellt, Wegweiser für englische Leser·innen eingefügt und beispielsweise den Bezug von „that source“ verdeutlicht. Die überarbeitete Version lautet:
Fat chance Kraft knows what he has to do. Doubts come faster than he’s able to marshal the previous night’s euphoria into a consistent train of thought. Failing euphoria, he struggles instead to grasp the thread through pragmatism and systematic thought, because, if he remembers correctly, the energy that had filled him in McKenzie’s room was nothing if not pragmatic and systemic.[12]Ders., Kraft. A Novel, a.a.O., S. 157.
Meiner Meinung nach weicht die zweite Version zwar von der Wörtlichkeit ab, vermittelt aber die gequälte Eleganz der Erzählung. Solche Überlegungen und Anpassungen meine ich, wenn ich sage, ich möchte meine Erfahrung des Originals für englische Leser·innen nachbilden.
Probleme der Wortwahl und der Semantik
Übersetzer·innen begegnen Walter Benjamin mit großen Beklemmungen, nicht nur der Komplexität seines Denkens und seiner Prosa wegen, sondern auch weil er die Messlatte für das Übersetzen unerreichbar hoch gelegt hat. In seinem vielzitierten Essay „Die Aufgabe des Übersetzers“ lesen wir, unsere Pflicht sei nichts weniger als die Rückgewinnung einer Ur-Sprache, einer reinen Ursprungssprache, die in irdischen literarischen Werken „behaftet [sei] mit dem schweren und fremden Sinn“.[13]Walter Benjamin, „Die Aufgabe des Übersetzers“, S. 9-21, in: Ders., Gesammelte Schriften, Band IV.i (Kleine Prosa, Baudelaire-Übertragungen), … Fußnote lesen Aufgabe des Übersetzers sei es, „[j]ene reine Sprache, die in fremde gebannt ist, in der eigenen zu erlösen, die im Werk gefangene in der Umdichtung zu befreien […]. Um ihretwillen bricht er morsche Schranken der eigenen Sprache“.[14]Ebd. Für das Ego von Übersetzer·innen und ihr Sendungsbewusstsein mag das Wunder wirken, beim Überwinden der Schranken zwischen den Sprachen, mögen sie auch noch so morsch sein, ist es keine große Hilfe.
Beim Übersetzen der um Benjamins wichtigen Text „Der Erzähler“ gruppierten Sammlung seiner Essays musste ich seine dynamische Verwendung der zentralen Begriffe Erfahrung und Erlebnis entflechten, für die das Englische nur einen hat ‒ experience. Das Konzept der Erfahrung ‒ ob direkt gewonnen oder aus zweiter Hand ‒ ist grundlegend für Benjamins Sicht des Geschichtenerzählens als Nexus der Sinngebung im menschlichen Leben. Sowohl Erfahrung als auch Erlebnis haben beeindruckende Stammbäume in Philosophie und Phänomenologie, wurzeln bei Aristoteles und wurden weiterentwickelt von Bacon, Husserl, Hegel, Kant, Bergson und anderen. Gleichwohl können diese Begriffe laut dem Dictionary of Untranslatables nach Maßgabe ihrer Etymologien begriffen werden. (Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die Herausgeber·innen des unverzichtbaren Philosophielexikons der Untranslatables erklärtermaßen nicht behaupten, die vielen Einträge in ihrem Wörterbuch seien per se unübersetzbar, sondern sie hätten sich angemessenen Übersetzungen bislang widersetzt und dieser Widerstand sei eine Quelle nuancierender Einsicht.)
Etymologisch geht Erlebnis also auf die Wurzel Leben zurück und konnotiert Unmittelbarkeit. Erfahrung geht auf die Wurzel fahren zurück und bezieht sich auf ein Wissen, das auf einer Reise, aus einer Begegnung oder auch den Wahrnehmungen anderer Menschen gewonnen wird. Erfahrungen können direkt oder aus zweiter Hand gemacht und daher in einem gewichtigeren Sinn weitergegeben werden als Erlebnisse. Benjamins Beitrag zu Verständnis und Verwendung der beiden Begriffe bestand darin, sie zu Bergsons Gedächtnistheorie in Beziehung zu setzen. Er verbindet Erfahrung mit dem Gedächtnis im allgemeinen und Erlebnis mit der Erinnerung als einer verinnerlichten, subjektiven Form des Gedächtnisses, die im Englischen meist als recollection gefasst wird. Benjamin nimmt es mit der Unterscheidung dieser verschiedenen Formen von Erfahrung und Gedächtnis allerdings nicht immer ganz genau, oder wie Kevin McLaughlin es ausdrückt: „The specific connection between experience and memory in Benjamin’s theory of Erfahrung is articulated through his manipulation of these four terms for which English equivalents have proven elusive.“[15]„Die spezifische Verbindung zwischen Erfahrung und Gedächtnis in Benjamins Theorie der Erfahrung kommt in seiner Handhabung der vier Begriffe zum … Fußnote lesen
Was bedeutet das für seine Übersetzerin? Ich hatte das Gefühl, in Treibsand zu versinken.
Unter den kürzeren und ungreifbareren Texten in der Storyteller-Zusammenstellung findet sich eine Überlegung zu Sprichwörtern. In einem Satz musste ich die Begriffe Erfahrung und Erlebnis entsprechend meiner Interpretation der Funktion einschränken, die sie nicht nur in diesem Satz, sondern im Kontext von Benjamins Denken haben.
Zum Sprichwort (1932)
Zu Grunde zu legen das Bild von den Frauen, die auf dem Kopf, ohne sie mit der Hand zu berühren, schwere, gefüllte Gefäße tragen.
Den Rhythmus, in dem sie das tun, lehrt das Sprichwort.
Es spricht aus ihm ein noli me tangere der Erfahrung.
Damit bekundet es seine Kraft, Erfahrung in Tradition zu verwandeln.
Sprichwörter sind nicht anwendbar auf Situationen. Sie haben vielmehr eine Art von magischem Charakter: sie verwandeln die Situation. Es ist kaum im Vermögen des Einzelnen gelegen, seine Erfahrungen ganz von Erlebnis zu reinigen. Aber das Sprichwort, indem es sich ihrer bemächtigt, bewirkt das.
Es macht die erlebte Erfahrung zu einer Welle in der atmenden Kette ungezählter Erfahrungen, die von Ewigkeit her kommen.[16]Walter Benjamin, „Zum Sprichwort“, in: Ders., Gesammelte Schriften, Band VI (Fragmente und autobiographische Schriften), Frankfurt/Main: Suhrkamp … Fußnote lesen
On Proverbs (1932)
Take, as a foundation, the image of women carrying full, heavy vessels on their heads without using their hands.
The rhythm in which they do this is what the proverb demonstrates.
A noli me tangere of experience speaks from the proverb.
And through this, the proverb declares its ability to transform experience into tradition.
Proverbs cannot be applied to a specific situation. Rather, they have a kind of magical character: they transform the situation. An individual hardly has the capacity to cleanse all the traces of personal experiences from the lessons learned in life. But proverbs can do this by appropriating those lessons.
They turn knowledge gained from experience into a wave in the endless, breathing chain of life lessons that come to us from eternity.[17]Walter Benjamin, The Storyteller Essays, hg. von Samuel Titan, aus dem Deutschen von Tess Lewis, New York: NYRB Classics 2019, S. 27 (Hervorhebungen … Fußnote lesen
Im siebten Satz ist die Reduktion von Erlebnis auf „lessons learned in life“ und von erlebte Erfahrung auf „knowledge gained from experience“ ein notwendiges Übel. Es ist eine Art Verrat, der aber in gutem Glauben, nach umfangreichen Recherchen und unter Qualen begangen wurde. Die Verleger literarischer Übersetzungen dulden selten Fußnoten oder Anmerkungen, um Leser·innen auf das Spektrum der Bedeutungen eines Worts oder einer Wendung hinzuweisen, daher musste ich meine Interpretation von Benjamins Absichten bei der Verwendung dieser Begriffe integrieren ‒ und mir dabei bewusst halten, dass mein Zielpublikum aus einer allgemeinen Leserschaft und nicht aus Begriffshistoriker·innen bestand. Und natürlich steht in Übersetzungen ein einzelnes Wort nie allein. Ich entschied mich, „lehrt das Sprichwort“ als „what the proverb demonstrates“ und nicht als „what the proverb teaches“ zu übersetzen, weil diese zweite Lösung das Sprichwort sonst zu eng mit dem „Erlebnis“ drei Abschnitte später verknüpft hätte. In diesem Text lehren Sprichwörter exemplarisch, während Lebenserfahrungen direkte Lektionen erteilen. Man kann sich leicht in solchen Einzelheiten verzetteln, aber Nuancen bewahrt man nur, wenn man diese Einzelheiten nicht übersieht.
Unvereinbare Zeit- und Modusformen
Der Konjunktiv wurde im Altenglischen ganz wie im Deutschen gebraucht, um die Wahrheit einer Aussage zu bezweifeln, um Irrealität, Wünsche, Bitten und Befehle auszudrücken oder aber um indirekte Rede wiederzugeben. Im Mittelenglischen verkümmerte er jedoch, als Flexionsendungen angeglichen und Verbformen vereinfacht wurden. Mittelenglisch wird übrigens von der normannischen Eroberung im Jahr 1066 und dem Jahr 1476 begrenzt, in dem in England die erste Druckerpresse den Betrieb aufnahm.
Der Konjunktiv spielt eine wichtige Rolle im Roman Engel des Vergessens der österreichischen Autorin Maja Haderlap. Haderlap kam in der slowenischen Sprachgemeinschaft in Kärnten, der südlichsten Region Österreichs, zur Welt. Am Anfang schrieb sie slowenische Gedichte, wechselte dann aber ins Deutsche, die Hauptsprache ihres Bildungsgangs, um dieses Werk zu schreiben ‒ eine Entscheidung, die von einem Gutteil der österreichischen Slowenen scharf kritisiert wurde, die verständlicherweise sehr auf ihre eigene Geschichte pochen. Hätte Haderlap ihren Roman aber nicht auf Deutsch geschrieben, wäre er auf eine sehr kleine Leserschaft beschränkt geblieben, und Engel des Vergessens hätte die nationale Diskussion über Österreichs Vergangenheit nicht so nachhaltig beeinflusst, wie es dann der Fall war.
Der Roman beruht auf den Erfahrungen von Maja Haderlaps Familie und ihrer Gemeinschaft, von denen im Zweiten Weltkrieg viele als Partisanen gegen die Nazis kämpften und seitens der deutschsprachigen Mehrheit in den Nachkriegsjahrzehnten Ressentiments und Misstrauen ausgesetzt waren. Er ist auch die Geschichte einer jungen Frau, die lernen muss, sich auf dem Minenfeld zweier verfeindeter Bevölkerungsgruppen und zweier extrem belasteter Sprachen zu bewegen: Slowenisch als der Sprache heroischen Widerstands und der anhaltend erlittenen Erniedrigung und Deutsch als dem Ausweg aus ihrem erstickenden ländlichen Elternhaus, aber auch der Sprache der Lager, die ihre Großmutter nur knapp überlebt hat und in denen viele Angehörige ermordet wurden.
Engel des Vergessens ist sowohl eine Erforschung der Brüchigkeit und Formbarkeit des kollektiven Gedächtnisses in bedrängten Minderheiten als auch ein Dokument der Kraft des Geschichtenerzählens. Während sie den sprunghaften und manchmal wirren Erzählungen von Verwandten und Nachbarn zuhört, erkennt die Erzählerin als Mädchen, dass die anderen keine echten Erzähler, sondern „Fasterzähler“ sind, denen die eigenen Geschichten im Kopf zerbröseln.
Als sie heranwächst, gelingt es ihr nach und nach, die Vergangenheit ihrer Gemeinschaft aus dem Abgrund der Geschichte zurückzugewinnen, und sie erkennt allmählich die Komplexität dieser Vergangenheit und ihrer Echos im Kärnten der Gegenwart. Dennoch ist ihre Identität untrennbar verbunden mit Geschichten, die sie aus zweiter Hand gehört hat, sowie den Traumata anderer Menschen. An diesem Punkt wird der Konjunktiv ein wesentliches Element der Erzählung. Die Erzählerin wechselt zwischen ihren eigenen Erinnerungen und denen anderer ab und damit zwischen direkter und indirekter Rede. Die Erzählung wird rhythmisch interpungiert von Angaben zu den Quellen der Geschichten oder wiedergegebenen Informationen: „sagt Großmutter“, „sagt Vater“, „sagt Tonči“ oder „wie man erzählt“. Es gibt auch Wechsel zwischen dem Indikativ und dem Konjunktiv I sowie plötzliche pronominale Sprünge, die der Unfähigkeit der Erzählerin Form geben, zwischen sich und ihrer Familiengeschichte Distanz zu schaffen. Diese Nuancen waren kaum noch einzufangen. In einer frühen Passage erinnert sich die Erzählerin an gemeinsame Haushaltsarbeiten mit ihrer Großmutter, die immer von einem Strom von deren Erinnerungen begleitet wurden. Der Rhythmus dieser Passage ist von großer Bedeutung für die Erzählstimme des Romans.
Sie sagt, sie habe auch Essen gestohlen für sich und die anderen, sie habe nach jeder Kartoffelschale gesucht, nach allem, was essbar schien, damals, als sie die Kessel gewaschen hat, das war noch ein Glück, sagt sie, dass sie dahin gekommen sei, in die Küche, im Lager, ich weiß.[18]Maja Haderlap, Engel des Vergessens, Göttingen: Wallstein 2011, S. 6f. (Hervorhebungen T.L.).
Die Unfähigkeit des Mädchens, ihre eigene Perspektive klar von der ihrer Großmutter zu trennen, zeigt sich komprimiert im ständigen Wechsel zwischen Konjunktiv I („habe“) und Indikativ („das war noch ein Glück“), zurück zum Konjunktiv („sei“) und wieder nicht nur zum Indikativ, sondern auch zur eigenen Perspektive („ich weiß“). Das alles wird im Englischen zwangsläufig eingeebnet.
She tells me she also stole food for herself and the others, she kept an eye out for every single potato peel, for anything that looked edible, back then, when she washed the cauldrons, it was great luck, she says, that she ended up in the kitchen, in the camp. I know.[19]Dies., Angel of Oblivion, aus dem Deutschen von Tess Lewis, New York: Archipelago 2016, S. 11.
Eines der Mittel, mit denen ich diese Einebnung zu kompensieren versucht habe, bestand in der Rekonstruktion, um nicht zu sagen der Betonung der verschiedenen Rhythmen von Majas Sätzen.
Erneuerbares Übersetzen ‒ ein erster Schritt
Übersetzen bietet die Gelegenheit, eine Sprache einem Stresstest zu unterziehen und sie zu beleben. Eliot Weinberger hat bemerkt: „many of the golden ages in literature have been, not coincidentally, periods of active and prolific translation.“[20]„Viele der goldenen Zeitalter der nationalen Literaturen waren, durchaus nicht zufällig, auch Zeiten aktiven, fruchtbaren Übersetzens“ ‒ … Fußnote lesen Nicht nur werden neue Genres, Stile und Formen in eine empfängliche Literaturtradition importiert, sondern auch die Ankunftssprache gewinnt neue Ausdrucksmittel und ‑techniken. Wie Weinberger weiter ausführt: „Translation liberates the translation language. Because a translation will always be read as … something foreign, it is freed from many of the constraints of the currently accepted norms and conventions in the national literature.“[21]„Die Übersetzung befreit die Sprache, in die übersetzt wird. Weil eine Übersetzung stets als Übersetzung gelesen wird, als etwas Fremdes, ist … Fußnote lesen Man denke an den amerikanischen Modernismus im frühen 20. Jahrhundert oder an die deutsche Literatur an der Wende zum 19. Jahrhundert. Und man denke an die Echos von Thomas Bernhards jähzornigen Erzählern und W.G. Sebalds melancholischen Wanderern in der zeitgenössischen englischsprachigen Belletristik.
Das Übersetzen ist per definitionem eine Übung im Brückenbauen zwischen Einzelnen und Gemeinschaften. Susan Sontag verstand das literarische Übersetzen als „preeminently an ethical task, and one that mirrors and duplicates the role of literature itself, which is to extend our sympathies; to educate the heart and mind; to create inwardness; to secure and deepen the awareness (with all its consequences) that other people, people different from us really do exist.“[22]„Literarisches Übersetzen […] ist vor allem eine ethische Aufgabe […], die die Rolle der Literatur selbst spiegelt und dupliziert, die … Fußnote lesen Wenn wir verstehen wollen, dass „Menschen, die anders sind als wir, wirklich existieren“ und zwar nicht nur in fremden Kulturen, sondern in Kulturen, die viele Gemeinsamkeiten mit unseren Werten und unserer Geschichte haben, müssen wir uns meiner Meinung nach mit ihren Grundannahmen und Denkprozessen auseinandersetzen.
Ich habe bei Büchern, die ich übersetzt habe, immer wieder ungute Gefühle gehabt. Am Anfang meiner Berufstätigkeit habe ich den Roman Hundert Tage des Schweizer Schriftstellers Lukas Bärfuss übersetzt. Er kartographiert den emotionalen und moralischen Zusammenbruch von David Hohl, einem Schweizer Entwicklungshelfer in Ruanda, der sich kurz vor Ausbruch des Genozids in eine Hutu-Frau verliebt. Als diese Frau ihn verschmäht, um eine besonders unbarmherzige Todesschwadron anzuführen, kommen Hohls bis dahin latenter Rassismus und seine Misogynie zum Ausbruch. Während der Lektoratsphase war mehrere Monate lang unklar, ob einige der anstößigsten Passagen ‒ insgesamt vier oder fünf Seiten ‒ in der englischen Ausgabe gestrichen würden. (Ich sollte darauf hinweisen, dass Übersetzer·innen bei der endgültigen Textgestalt nicht immer das letzte Wort haben, aber das wäre ein Thema für eine eigene Veranstaltung.) Am Ende wurde meine Übersetzung One Hundred Days ungekürzt veröffentlicht, weil diese Passagen ein entscheidendes Element der beißenden Kritik der vorsätzlichen Blindheit sind, die manche humanitären und sogenannt ‘sanft diplomatischen’ Initiativen an den Tag legen, die von wohlhabenden Ländern finanziert werden, deren Regierungen zu arrogant oder aber zu faul sind, um die unbeabsichtigten oder indirekten Konsequenzen der von ihnen finanzierten Programme zu untersuchen. Wären dieser Kritik die Krallen gestutzt worden, wäre Bärfuss’ Roman weniger anstößig gewesen, seine Fähigkeit, Leser·innen zu provozieren, ihre eigenen Grundannahmen und Motive sowie die ihrer staatlichen Institutionen zu hinterfragen, wäre aber auch abgestumpft worden.
One Hundred Days kam mitsamt den fragwürdigen Passagen auf die Shortlist eines großen Übersetzungspreises, aber ein leises Unbehagen ist mir geblieben. Ich fürchte, heutige Sensitivity-Leser·innen würde dieser Roman nicht überleben. Es ist schwierig und gefährlich, verbindliche Regeln aufzustellen, was in Übersetzungen entschärft oder geglättet werden sollte und was nicht. Es gibt immer noch viele Fälle, bei denen anstößige Sprache auf nachlässige, unverantwortliche, schädliche und verständnislose Weise verwendet wird. Nur können wir unsere Verschiedenheiten oder die hässlicheren Seiten unserer Geschichten nicht einfach übertünchen oder fortwünschen.
Isabel Fargo Cole hat ihre Erfahrungen beim Übersetzen des ostdeutschen Autors Wolfgang Hilbig beschrieben, bei dem es zahllose Passagen gibt, die „contain the entire toxic history of male hysteria which a generation of young feminists […] is struggling to dismantle, word by word“.[23]„die ganze toxische Geschichte der männlichen Hysterie, die eine Generation junger Feministen […] Wort für Wort abzutragen bemüht ist“ … Fußnote lesen Ihr Unbehagen wurde weniger von der belasteten Sprache selbst ausgelöst als von der Erwartungshaltung ihres Lektors, sie würde die Figurenstimmen zähmen oder mit einer Art glättenden Membran abdecken. Sie weist auf die absehbaren Gefahren hin, wenn man die Reibungsflächen beseitigt, die bei der Konfrontation mit Ansichten entstehen, die unseren eigenen radikal zuwiderlaufen: „The proposition of frictionless identification can be a dead end ‒ not just for the reader, but also and especially for the translator. The assumption of innate affinity can cause blindness, makes it all too easy to project yourself onto the other. You end up standing in your own way.“[24]„Nicht nur beim Lesen, gerade beim Übersetzen kann das Angebot der reibungslosen Identifikation in die Sackgasse führen. Die Annahme … Fußnote lesen Bis zu welchem Grad können wir es uns leisten, unserem Wunsch nach Behaglichkeit Einsichten in die dunklen Triebe zu opfern, denen alle Menschen unterworfen sind?
Wenn wir uns selbst und andere verstehen wollen, müssen wir wissen, wo wir und sie herkommen. Wo immer es um brisante oder anstößige Sprache geht, muss individuell nach deren Funktion und Wirkung im jeweiligen Text gefragt werden. Ich habe hoffentlich zeigen können, dass bei Übersetzungen alles vom Kontext abhängt. Wenn wir ‒ vertraute oder fremde ‒ Kontexte ignorieren, tun wir das auf eigene Gefahr.
David Bellos liefert ein bündiges Plädoyer für die ungeschminkte Übersetzung, wenn er in Is that a Fish in Your Ear? konstatiert: “Translating is a first step towards civilization.”[25]„Übersetzen ist ein erster Schritt hin zur Zivilisation“ ‒ David Bellos, Was macht der Fisch in meinem Ohr? Sprache, Übersetzen und die … Fußnote lesen Alle Zivilisation hängt schließlich von der Kommunikation zwischen verschiedenen Menschengruppen ab. Ohne Kommunikation gibt es keine Hoffnung auf eine gemeinsame Basis. Übersetzen ist unentbehrlich, bleibt aber ein provisorisches und gewagtes Unterfangen. Wenn die von Übersetzungen gebauten Brücken eher filigranen Hängebrücken als wuchtigen Steinkonstruktionen gleichen, sind sie deswegen noch lange nicht weniger notwendig oder zuverlässig.
Ursprünglich vorgetragen am 3. März 2022 in der American Academy in Berlin mit aufrichtigem Dank für deren Unterstützung.
| ↑01 | P.E.N. Translation Committee, Manifesto on Translation. („Allzu lange waren die Übersetzer die verlorenen Kinder im verwunschenen Wald der Literatur. Ihre Namen werden in der Regel vergessen, sie sind grotesk unterbezahlt, und ihre Arbeit betrachtet man, sei sie auch noch so versiert, mit dem leicht herablassenden und mitleidigen Respekt, der früher jungen Hausangestellten vorbehalten blieb.“) |
|---|---|
| ↑02 | Esther Allen und Susan Bernofsky (Hgg.), In Translation. Translators on Their Work and What It Means, New York: Columbia UP 2013, S. 98. („Die herkömmliche Meinung verachtet sie als bloße Kopisten und misstraut ihnen zugleich, weil sie nicht bloß Kopisten sind.“) |
| ↑03 | Barbara Cassin, Emily Apter und Michael Wood (Hgg.), Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon, Princeton: Princeton UP 2014, S. xiv. („Nichts bedeutet in einer Sprache genau dasselbe wie in einer anderen, das Scheitern des Übersetzens ist also immer zwangsläufig und absolut. Nicht nur vernachlässigt diese These die Tatsache, dass einige ziemlich gute Äquivalenzen vorliegen, sie beruht auch auf einer Mystifikation, auf dem Traum von einer Vollkommenheit, die weder wünschenswert noch machbar ist.“) |
| ↑04 | „This is translation not quite as autobiography but maybe as ‘autography’: turning out my pockets, Schwitters-style, a bus ticket, a scrap of newspaper, a fag packet, a page torn out of a diary“ – Michael Hofmann, Where Have You Been. Selected Essays, New York: Farrar, Straus and Giroux 2014, S. 201. („Eine solche Übersetzung fällt vielleicht weniger unter Autobiographie als unter ‚Autographie‘: Ich leere meine Taschen aus à la Schwitters: eine Busfahrkarte, ein Zeitungsausriss, eine Zigarettenschachtel, eine aus einem Tagebuch herausgerissene Seite“) |
| ↑05 | Judith Keller, Die Fragwürdigen, Luzern: Der gesunde Menschenversand 2017 (edition spoken script 23), S. 26. „Fidelity. In being true to him, she’s afraid she’s not being true to herself. She doesn’t know if she would like to be true to herself. It’s not clear to her, to whom then she should be true.“ ‒ Judith Keller, The Questionable Ones, aus dem Deutschen von Tess Lewis, Kolkata: Seagull Books 2023 (im Erscheinen). |
| ↑06 | „Die interessantesten Beispiele übersetzerischer ‚Transfiguration‘ sind sowohl aus methodischer als auch aus geistesgeschichtlicher Sicht jene, in denen ein Übersetzer das Original unwillentlich ‚nach oben betrügt‘.“ ‒ George Steiner, Nach Babel. Aspekte der Sprache und des Übersetzens (1972), aus dem Englischen von Monika Plessner unter Mitwirkung von Henriette Beese, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1981, S. 384. |
| ↑07 | „Vereinfachen Sie mich. Ändern Sie mich. Machen Sie mich schlicht. Meine Sprache ist mir oft peinlich. Sie ist zu jugendlich, zu romanisch … Ich wünsche mir die Kraft von Cynewulf, Beowulf, Beda. Machen Sie mich hager, zum Macho, zum Gaucho.“ ‒ Zit. nach Edwin Honig (Hg.), The Poet’s Other Voice. Conversations on Literary Translation, Amherst: Univ. of Massachussetts Press 1985, S. 62. |
| ↑08 | Jonas Lüscher, Kraft. Roman, München: C.H. Beck 2017, erneut München: btb 2018, S. 228 (Hervorhebungen T.L.). |
| ↑09 | Ders., Kraft. A Novel, aus dem Deutschen von Tess Lewis, New York: Farrar, Straus and Giroux 2020, S. 206 (Hervorhebungen T.L.). |
| ↑10 | ‚die bittere Pille schlucken‘, ‚Kreide fressen‘ (Anmerkung U.B.). |
| ↑11 | Jonas Lüscher, Kraft. Roman, a.a.O., S. 175 (Hervorhebung T.L.). |
| ↑12 | Ders., Kraft. A Novel, a.a.O., S. 157. |
| ↑13 | Walter Benjamin, „Die Aufgabe des Übersetzers“, S. 9-21, in: Ders., Gesammelte Schriften, Band IV.i (Kleine Prosa, Baudelaire-Übertragungen), Frankfurt/Main: Suhrkamp 1980, S. 19. |
| ↑14 | Ebd. |
| ↑15 | „Die spezifische Verbindung zwischen Erfahrung und Gedächtnis in Benjamins Theorie der Erfahrung kommt in seiner Handhabung der vier Begriffe zum Ausdruck, für die es im Englischen nur unzureichende Äquivalente gibt.“ ‒ Dictionary of Untranslatables, a.a.O., S. 649. |
| ↑16 | Walter Benjamin, „Zum Sprichwort“, in: Ders., Gesammelte Schriften, Band VI (Fragmente und autobiographische Schriften), Frankfurt/Main: Suhrkamp 1985, S. 206f. (Hervorhebungen T.L.). |
| ↑17 | Walter Benjamin, The Storyteller Essays, hg. von Samuel Titan, aus dem Deutschen von Tess Lewis, New York: NYRB Classics 2019, S. 27 (Hervorhebungen T.L.). |
| ↑18 | Maja Haderlap, Engel des Vergessens, Göttingen: Wallstein 2011, S. 6f. (Hervorhebungen T.L.). |
| ↑19 | Dies., Angel of Oblivion, aus dem Deutschen von Tess Lewis, New York: Archipelago 2016, S. 11. |
| ↑20 | „Viele der goldenen Zeitalter der nationalen Literaturen waren, durchaus nicht zufällig, auch Zeiten aktiven, fruchtbaren Übersetzens“ ‒ „Anonyme Quellen (Übersetzer & Übersetzungen. Ein Vortrag)“, in: Orangen! Erdnüsse!, aus dem Englischen von Peter Torberg, Berlin: Berenberg 2011, S. 135. |
| ↑21 | „Die Übersetzung befreit die Sprache, in die übersetzt wird. Weil eine Übersetzung stets als Übersetzung gelesen wird, als etwas Fremdes, ist sie frei von den Beschränkungen der gegenwärtig akzeptierten Normen und Konventionen der jeweiligen Nationalliteratur“ ‒ Ebd., S. 137. |
| ↑22 | „Literarisches Übersetzen […] ist vor allem eine ethische Aufgabe […], die die Rolle der Literatur selbst spiegelt und dupliziert, die ihrerseits darin besteht, unser Mitgefühl zu erweitern; Herz und Verstand zu bilden; Innerlichkeit zu schaffen; das Bewusstsein zu festigen und zu vertiefen (mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben), dass andere Menschen, Menschen, die anders sind als wir, wirklich existieren“ ‒ „Die Welt als Indien. Hieronymus-Vorlesung über literarisches Übersetzen“ (2002), S. 202-29, in: Zur gleichen Zeit. Aufsätze und Reden, hg. von Paolo Dilonardo und Anne Jump, mit einem Vorwort von David Rieff, aus dem Englischen von Reinhard Kaiser, München: Hanser 2008, erneut Frankfurt/Main: S. Fischer 2010, S. 226. |
| ↑23 | „die ganze toxische Geschichte der männlichen Hysterie, die eine Generation junger Feministen […] Wort für Wort abzutragen bemüht ist“ ‒ Isabel Fargo Cole, „Das Messer und die Wunde. Grenzverletzungen bei Wolfgang Hilbig“, in: Toledo Talks. |
| ↑24 | „Nicht nur beim Lesen, gerade beim Übersetzen kann das Angebot der reibungslosen Identifikation in die Sackgasse führen. Die Annahme naturgegebener Nähe kann blind machen, zum Hineinprojizieren eigener Befindlichkeiten verleiten. Man kann sich selbst im Wege stehen“ ‒ Ebd. |
| ↑25 | „Übersetzen ist ein erster Schritt hin zur Zivilisation“ ‒ David Bellos, Was macht der Fisch in meinem Ohr? Sprache, Übersetzen und die Bedeutung von allem, aus dem Englischen von Silvia Morawetz, Frankfurt/Main: Eichborn 2013, S. 421. |