Zeit und Zumutung – vom Übersetzen umfangreicher Texte
Wer einen Klassiker von tausend Seiten übersetzt hat, wird ständig gefragt, wie lange er dafür gebraucht habe. Stefan Moster geht der Frage nach, worin die wahren Herausforderungen beim Übersetzen umfangreicher Texte bestehen.
– „Wie lange haben Sie an dieser Übersetzung gearbeitet?“ –
Diese Frage wird mir stets gestellt, wenn ich den Roman Im Saal von Alastalo von Volter Kilpi vorstelle oder jemand den Band in meiner Gegenwart aus dem Schuber zieht, die anderthalb Kilo in der Hand wiegt, und in den 1136 Seiten (mit Nachwort und Glossar) blättert. Die Frage nach der Zeit, die ich für die Übertragung des Buches investiert habe, scheint unvermeidlich, lässt jedoch eine Kluft zwischen der fragenden Person und mir entstehen, denn für mich steht sie nicht an erster Stelle. Gegenüber all den anderen Herausforderungen, die bei dieser exzeptionellen Übersetzungsarbeit zu bewältigen waren, kommt mir die schiere Dauer nachrangig vor. Beim ersten Mal war ich mit der Frage sogar überfordert und nuschelte verlegen, der ganze Prozess habe wohl ungefähr drei Jahre in Anspruch genommen.
So sage ich es jetzt immer, und alle geben sich damit zufrieden. Allerdings meine ich, jedes Mal einen Hauch von Enttäuschung bei den Fragenden wahrnehmen zu können. Lieber wäre ihnen, wenn ich sagte: Sieben Jahre. Oder noch besser: zwölf. Sie wollen hören, dass der Kunst Lebenszeit beträchtlichen Ausmaßes dargebracht worden ist. Als werte das Opfer das Werk auf und verdeutliche, dass es nicht bloß dick ist, sondern groß. Ein wohliger Schauer der Unheimlichkeit überläuft die Menschen bei der Vorstellung, dass da einer jahrelang an der Übersetzung eines exzentrischen finnischen Klassikers, dessen Verfasser niemand kennt, gewerkelt hat und dabei der Welt fast abhandengekommen wäre.
„Die magische Grenze: 1000 Seiten“
Wann greift bei einem literarischen Werk das Adjektiv „umfangreich“ überhaupt? Ich schätze, dass die magische Grenze bei tausend Seiten liegt. Gleichzeitig glaube ich, dass es beim Faszinosum „umfangreiches Buch“ nicht allein ums zählbare Tausend geht, denn dicke Bücher gibt es jede Menge und nicht jedes wird bestaunt. In diversen Genres – von Fantasy über Thriller bis hin zur Romantik und zur Biografie (die ja nicht selten eine Synthese der zuvor genannten ist) – bilden dicke Schinken sogar eher die Regel als die Ausnahme. Zur reinen Seitenzahl müssen Eigenschaften hinzukommen, die der Länge erst die eigentliche Brisanz verleihen, oder wenigstens Scheineigenschaften wie „schwer“, „verrückt“, „unübersetzbar“. Es müssen außergewöhnliche Schwierigkeiten zu ahnen sein. Es geht letztlich um das Verhältnis von Zeit und Zumutung.
Die lange andauernde Zumutung ist es, die uns erschaudern lässt.
Die Zumutungen bei der Übersetzung von Volter Kilpis Alastalon salissa (so der Originaltitel des 1933 erschienen Werks) bestehen im speziellen Sprachgebrauch des Autors. Sein Roman spielt innerhalb von sechs Stunden in einem einzigen Raum, im Saal des Hofes Alastalo in der finnischen Schärengemeinde Kustavi. Dort haben sich Mitte der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts achtundzwanzig Männer versammelt, um über den gemeinsamen Bau einer Bark übereinzukommen, welche die Handelsaktivitäten der örtlichen Bauernkapitäne auf ein neues Niveau heben und der Gemeinde weiteren Wohlstand bescheren soll. Die Männer belauern sich, erzählen sich Geschichten, reden um den heißen Brei herum, fechten innere Kämpfe aus – bis schließlich tatsächlich Schiffsanteile gezeichnet werden und der Barkvertrag unterschrieben wird. Kilpi lässt die Charaktere bevorzugt durch die Erzählmittel Innerer Monolog und Bewusstseinsstrom Gestalt annehmen und widmet jedem Detail, jeder Regung mit furioser Sprache seine volle Aufmerksamkeit. Die verschlungenen Sätze bersten vor übereinander getürmten Metaphern, stecken voller Witz, enthalten Elemente aus dem bäuerlichen und maritimen Leben, warten mit dialektalem Material, seltenen Wörtern, reichlich Neologismen auf und sind komplett durchrhythmisiert. Der Klang trägt zu ihrer Bedeutung ebenso viel bei wie der Inhalt. Dabei lässt die Intensität an keiner Stelle nach. Im Grunde ist man als Übersetzer gefordert wie bei der Übertragung eines Gedichts. Bloß dass sich dieses über tausend Seiten erstreckt.
Aufgrund des eigenwilligen Tons und des extrem großen Wortschatzes inklusive ungebräuchlicher und neuer Vokabeln, gilt der Roman als ultimative übersetzerische Herausforderung. Einige Kollegen aus anderen Ländern haben ihre Versuche früh aufgegeben, sodass bislang nur eine schwedische und nun eben auch eine deutsche Ausgabe vorliegen.
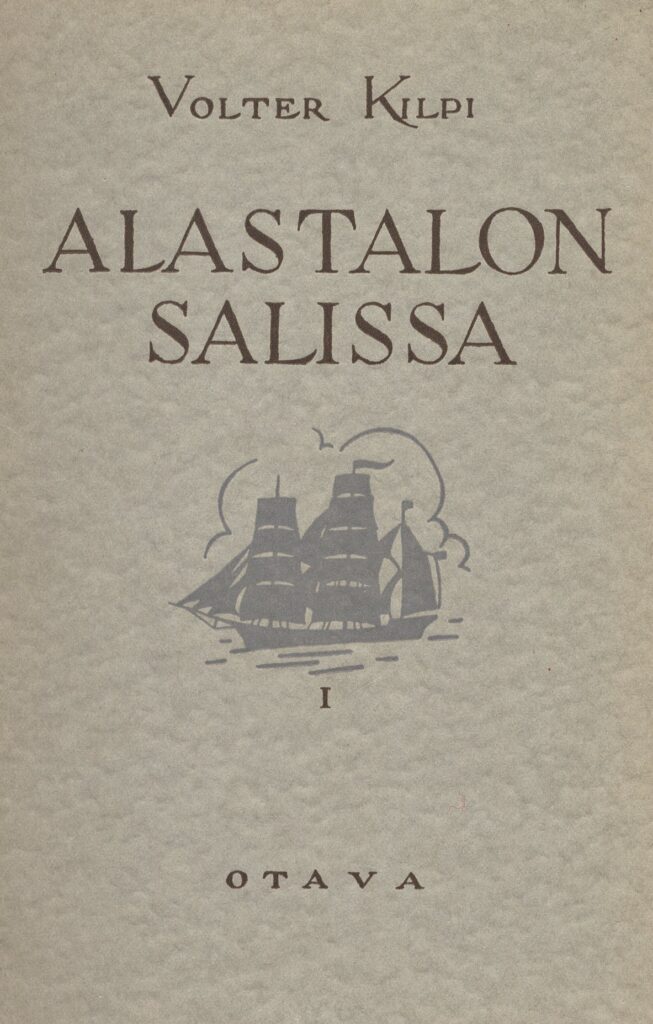
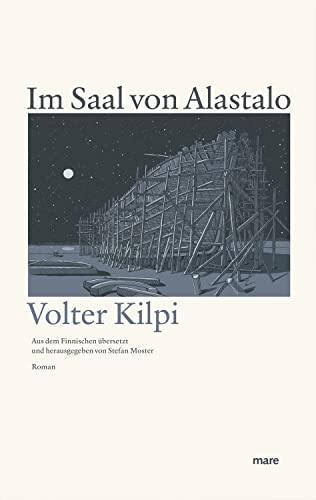
Wenn man nun als Übersetzer weiß, was einen an Zeitaufwand und Zumutung erwartet, kommt es auf die Haltung an, mit der man die Arbeit in Angriff nimmt, um nicht vor Angst zu erstarren. Man darf die Anforderung nicht größer machen, als sie ist, muss zugleich aber eine klare Vorstellung davon haben, mit welchem Rüstzeug man ausgestattet ist. Ich kam zuerst im Jahr 2008 auf die Idee, den Roman zu übersetzen, wusste jedoch, dass meine Fähigkeiten noch nicht ausreichten. Erst zehn Jahre später sah ich mich in sprachlicher Hinsicht, aber auch was die Nervenstärke und das Durchhaltevermögen betraf, dazu in der Lage, so große Schwierigkeiten auf so langer Strecke bewältigen zu können.
Eine Mischung aus Augenmaß, Entschlossenheit und Abenteuerlust sollte die Einstellung tragen, mit der man an die Sache herangeht. Das heißt freilich nicht, dass man mit dieser mentalen Ausstattung automatisch souverän bleibt. Großer Umfang und außerordentliche Zumutungen erzeugen im Zusammenspiel extreme Langsamkeit, und die hat das Zeug dazu, einen verrückt zu machen. Wenn man einen halben Tag benötigt, um einen einzigen, wenn auch überlangen Satz zu übertragen, fragt man sich unwillkürlich, wo das bei tausend Seiten hinführen soll. Überdies lässt die Langsamkeit ernst zu nehmende Probleme entstehen, die außerhalb des Textes liegen.
„Maximal drei Seiten pro Tag schienen realistisch, hieß, wenn man etwas Luft ließ: 400 Arbeitstage.“
Eine zeitintensive Übersetzung ist schwer einzuplanen, zumal, wenn man als Übersetzer:in einen gewissen Vorlauf hat. Dann stellt sich die Frage, wie man im Arbeitsablauf den nötigen Platz findet, ohne bestehende Verträge zu gefährden. Überdies ist man bei einem so großen Projekt gezwungen, über einen längeren Zeitraum hinweg andere Aufträge abzulehnen, was die Gefahr mit sich bringt, vom „Markt“ zu verschwinden, also nach der außerordentlichen keine normalen Übersetzungen mehr zu bekommen. Damit hätte man sich ausgerechnet mit einer kulturellen Großtat aus dem Beruf gekegelt. Die Meriten durch die große Übersetzung schlagen nämlich, wenn überhaupt, erst nach der Publikation zu Buche, die sich wiederum hinauszögert, weil alle dazugehörigen Prozesse – Lektorat, Korrektur, Herstellung – mehr Zeit als üblich in Anspruch nehmen.
Bei einem umfangreichen Thriller, der einfach geschrieben ist, kann ich vorab entscheiden, wie viel Lebenszeit ich dafür aufzuwenden bereit bin, und auf dieser Grundlage ausrechnen, wie viele Seiten ich pro Tag übersetzen muss. Bei einem umfangreichen Werk mit außerordentlichen Anforderungen geht das nicht. Bei Kilpis Roman setzte ich zweihundert Arbeitstage an, begriff aber schon am ersten Tag, dass ich meinen Plan revidieren muss. Maximal drei Seiten pro Tag schienen realistisch, hieß, wenn man etwas Luft ließ: 400 Arbeitstage. Fast zwei Jahre. Plus Lektorat und Fahnenkorrektur. Die Vorarbeiten hatte ich da bereits erledigt: die Recherchen über Kilpi, über die Zeit, in der sein Roman spielt und über den Schauplatz und dessen Kulturgeschichte, und natürlich die genaue Lektüre, zum großen Teil sogar laut (was meiner Frau, die Finnin ist, große Freude bereitete), um ein Gefühl für den Rhythmus und Klang der Sprache zu entwickeln.
Am ersten Tag gab ich übrigens auch den Plan auf, ein Arbeitsjournal zu führen, weil ich erkannte, dass mir die Kraft dazu fehlen würde. Ich musste meine ganze Energie auf die eigentliche Übersetzungsarbeit richten. Dieses Buch zwang mir seinen Rhythmus auf und verlangte mir alles ab. Mir blieb nichts übrig, als mich zu fügen.
Damit ist die profane Seite des Projekts noch nicht erschöpft, denn die von Umfang und Schwierigkeiten erzwungene Langsamkeit hat zur Folge, dass sich die Arbeit „nicht rechnet“. Weil sie so fordernd ist, kann man nebenher kaum etwas anderes machen, und selbst ein anständiges Honorar deckt bei tausend Seiten nicht mehr als die Lebenshaltungskosten eines Jahres. Sprich: ohne Förderung geht es nicht. Ich konnte mich glücklich schätzen, vom Deutschen Übersetzerfonds und vom Finnischen Kulturfonds unterstützt worden zu sein. Das half mir wesentlich dabei, unter der Dauer nicht zu leiden.
Was mich mit der Dauer am meisten versöhnte, war allerdings der Gedanke an den Verfasser und an das Glück der Leser:innen. Kilpi hatte Weltliteratur geschrieben. Das musste gewürdigt und dem deutschsprachigen Publikum nahegebracht werden. Ich setzte meine Mühe für einen großen Autor und für ein Werk der Weltliteratur ein – das war die beste Motivation.
Gleichzeitig ermöglichte mir der Umstand, dass ich so lange mit einem Text so hoher Qualität befasst war, die Erfahrung, mich zu entwickeln. Ich wurde besser, ich lernte viel über die Möglichkeiten der Literatur hinzu, erweiterte meinen Wortschatz im Finnischen wie im Deutschen. Die Sprache nahm mich immer mehr für sich ein, und meine Bewunderung für den Autor wuchs. Oft staunte ich nach dem Kampf mit einem seitenlangen Satz darüber, wie kunstvoll Kilpi die Fäden zusammenführt. Die Freude daran nahm mit der Dauer der Arbeit zu, und diese Erfahrung ist es, die mir die Frage nach der schieren Länge obsolet macht. Das Gefühl, an etwas Großem beteiligt zu sein, entkräftet den Faktor Zeit.
Volter Kilpi schrieb neun Jahren lang an dem Roman und musste sich dabei dem Faktor Zeit in doppelter Hinsicht stellen. Erstens kaufte er sich Zeit, indem er, damals Leiter der Universitätsbibliothek in Turku, aus eigener Tasche Aushilfen bezahlte, die einen Teil seiner Bibliotheksarbeit verrichteten, damit er vormittags schreiben konnte. Zweitens setzte er innerhalb der gekauften Zeit diese gewissermaßen außer Kraft, indem er sich nicht von ihr drängen ließ, sondern sich für seine Sätze so viele Minuten und Stunden nahm, wie es diese Sätze erforderten. Oft habe er lange auf der Lauer gelegen, um die passenden Formulierungen zu erhaschen, schreibt er in einem Brief an einen Freund. Es ging ihm ums Ganze, er wollte ein Buch über „die kosmische Dichte des Lebens“ und eine Art Total-Epos über die Welt seiner Herkunft schreiben, wie er seinem Verleger in einem Brief erklärte. Da durfte die Zeit nicht stören, sondern sollte, im Gegenteil, dem Werk zugutekommen.
„Drei Jahre in dem Bewusstsein, sich für ein literarisches Werk ins Zeug zu legen, das den Aufwand wert ist.“
Drei Jahre gegenüber neun. Drei Jahre in dem Bewusstsein, sich für ein literarisches Werk ins Zeug zu legen, das den Aufwand wert ist. Kein Grund sich zu beklagen, scheint mir. Ob Volter Kilpi mit mir zufrieden wäre? Die Sache mit dem Glück der Leser:innen scheint sich jedenfalls zu bestätigen. Nie zuvor hat mich so viel Post von Menschen erreicht, die nach der Lektüre ihre Begeisterung mit mir teilen wollen und somit dafür sorgen, dass meine Freude am umfangreichen Werk anhält.




